Wenn ich in Berlin bin, wo so vieles an die Teilung erinnert, denke ich oft zurück an meine Kindheit in den späten vierziger, frühen fünfziger Jahren, die ich ebenfalls in einer geteilten Stadt verbrachte. Das war nicht in Berlin, sondern in Linz. In Linz an der Donau.
Meine Heimatstadt Linz wurde von den Alliierten nach ihrem Sieg über Hitlerdeutschland (dem Österreich im März 1938 angeschlossen wurde, unter dem Jubel der Mehrheit der Österreicher) in zwei Besatzungszonen geteilt: Nördlich der Donau war die russische, südlich die amerikanische Zone. Die sogenannte Demarkationslinie verlief in der Mitte des Stromes. Auf der nach Vorstellungen Adolf Hitlers erbauten Donaubrücke, Nibelungenbrücke genannt, standen jetzt, an Stelle der von den Nazis vorgesehenen monumentalen Reitergestalten von Siegfried und Kriemhild, die Kontrollposten der Amerikaner und Russen, die man in den ersten Nachkriegsjahren nur mit Bangen passierte, wie ich aus Erzählungen älterer Menschen weiß.
Damals war die andere Seite Europas ganz nah, über der Donau, mit der Straßenbahn, die wir in Linz Tramway nannten, erreichbar. Und sie war nicht fremd, wie in späteren Jahren, sie war nicht anders, denn drüben wohnten Freunde und Verwandte, wie mein Onkel Egon und Tante Marianne, beide rundliche, gemütliche, lustige Leute, Tante Marianne buk obendrein herrliche Mehlspeisen.
Doch bei aller Nähe war die andere Seite zugleich unheimlich, bedrohlich sogar. Die Zonengrenze, die damals durch unser Land schnitt, galt, nicht ohne Grund, als gefährlich, für viele Menschen wurde sie zu einem Symbol für Misstrauen und Angst. Wir fuhren nur hinüber auf die andere Seite, wenn es sich nicht vermeiden ließ.
Die leben drüben, hinter dem Eisernen Vorhang, sagten wir von Onkel Egon, Tante Marianne und den anderen, die über der Donau wohnten, im russisch verwalteten Teil von Linz, im Osten, und in diesen Worten schwangen Mitgefühl und Bedauern mit, schließlich konnten sie nichts für ihr Schicksal, doch wir, die wir uns diesseits befanden, in der westlichen, amerikanischen Zone, waren eindeutig besser dran. Wir waren vom Schicksal begünstigt.
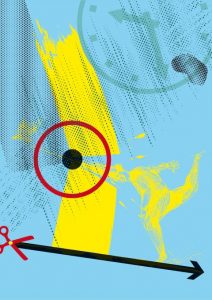
Die drüben betrachteten wir als die armen Verwandten. “Die armen Verwandten.” Diese Einstellung, ein Überlegenheitsgefühl, begleitet von Mitleid, das jedoch leicht in Unduldsamkeit, ja Ablehnung umschlagen kann, übertrugen wir später auf unsere Nachbarländer und ihre Bewohner, die nach 1945 dem stalinistischen Imperium zufielen, nicht aus eigener Schuld, sondern als Folge historischer Ereignisse, denen sie wehrlos ausgeliefert waren: des Hitler-Stalin-Pakts vom 23. August 1939, des am 1. September 1939 von Hitlerdeutschland vom Zaun gebrochenen Krieges, der Konferenz von Jalta im Februar 1945, um nur ein paar relevante Daten zu nennen.
Polen, Tschechen, Slowaken, Ungarn, Slowenen und Kroaten, alle Nachbarn, die nach 1945 auf der anderen, unfreien Seite zu liegen kamen, betrachteten wir, bestenfalls, als arme Verwandte, die unser Mitgefühl verdienten, allerdings aus der Distanz. Wie bei armen Verwandten üblich, tendierten wir auch dazu, sie zu demütigen, wenn sich die Gelegenheit bot, und sie von oben herab zu behandeln. Schließlich waren wir die Erfolgreichen, die Wohlhabenden, die von ihnen Beneideten, wir waren etwas Besseres. Unsere war die schönere, buntere Seite Europas.
Mit der Zeit keimte der Verdacht auf, dass die Nachbarn möglicherweise nicht ohne eigenes Zutun in ihre missliche Lage geraten waren. Vielleicht hatten sie sich ihr Schicksal, zumindest teilweise, selber eingebrockt? Immerhin hatten wir, oder eher unsere Eltern, es auch geschafft, uns von ganz unten, aus Ruinen, Trümmern und Elend, erneut emporzuarbeiten zum Wohlstand. Es musste doch einen Grund geben dafür, dass sie das nicht zustande gebracht hatten. Waren sie vielleicht weniger ordentlich, weniger fleißig als wir?
Solche Vorurteile gegenüber den Menschen in Ostmitteleuropa, Vorurteile, die sich historisch weit zurückverfolgen lassen, waren besonders häufig in der Generation anzutreffen, die aktiv am Krieg teilgenommen hatte, der im Osten ungleich verlustreicher geführt wurde als im Westen. Auch spätere Generationen, wir und unsere Kinder, übernahmen diese abschätzigen Klischees mit einer Leichtfertigkeit, für die wir uns heute schämen müssen.
Bei den Menschen, die den Eroberungskrieg Hitlers mitgemacht hatten, kam darin wohl auch eine gewisse Genugtuung, ja Schadenfreude zum Ausdruck. Das war die Rache der Besiegten an den Siegern, die sich nur wenige Jahre nach Beendigung des Krieges als die wahren Verlierer erwiesen – politisch ebenso wie wirtschaftlich.
Ich habe noch im Ohr, wie meine Großmutter, eine überzeugte Nationalsozialistin bis zum letzten Atemzug, jedes Mal reagierte, wenn die Rede auf die materielle Not und Unfreiheit der tschechischen Nachbarn kam: Geschieht ihnen ganz recht, warum haben sie auch unsere arme SS in Prag an den Füßen aufgehängt.
“Unsere arme SS.” Dass ihr Sohn, mein Vater, sich als leitender Angehöriger der SS und Gestapo an Kriegsverbrechen in Ostmitteleuropa beteiligt hatte, in Polen und in der Slowakei, wollte die Großmutter nicht wahrhaben. Davon wollte sie nichts wissen.
Meine Großmutter schenkte mir so viel Liebe, so viel Geborgenheit, wie man sich als Kind nur wünschen kann, gleichzeitig war sie eine harte, verbohrte, unbelehrbare Frau, voller Hass und Verachtung gegenüber denen im Osten, wie sie das pauschal ausdrückte. Diese Gefühle versuchte sie auch mir, dem grenzenlos geliebten Enkel, mit allen ihr zur Verfügung stehenden Mitteln einzuimpfen.
So wie ich wurden viele meiner Generation erzogen. In Österreich, vermutlich auch in Deutschland.
Unser Verhältnis zur anderen Seite Europas wurde lange Zeit durch die Geschichte belastet, vo

ran die nationalsozialistischen Verbrechen in Osteuropa. Es brauchte einige Zeit, bis wir begriffen, dass der Weg zur Verständigung mit den Nachbarn nur über eine schonungslose Auseinandersetzung mit den dunklen Kapiteln der eigenen Vergangenheit führen kann, schonungslos uns selber, aber auch unseren Vätern und Großvätern gegenüber. Und in meinem individuellen Fall schonungslos der geliebten Großmutter gegenüber, die in der Familie die Rolle des uneinsichtigen Ideologen einnahm. Natürlich war das oft schmerzhaft.
Wichtig bei der notwendigen Beschäftigung mit der Vergangenheit ist es, nie der Versuchung zu erliegen, von uns verübtes Unrecht gegen von uns erlittenes aufzurechnen, Konzentrationslager gegen Vertreibungen, Massenexekutionen gegen Brandbomben.
Solche Rechnungen, das haben wir gelernt, können nicht aufgehen, sie tragen höchstens dazu bei, die Aussöhnung mit den Anderen zu erschweren, wenn nicht unmöglich zu machen.
Das heißt nicht, dass wir nicht über das von uns erlittene Unrecht sprechen und schreiben dürfen. Das ist unerlässlich. Aber aufrechnen dürfen wir nicht.
Wie lang die Schatten sind, die die Vergangenheit wirft, wird uns 2009, in diesem Jahr der Jahrestage besonders deutlich bewusst. In diesem Jahr begangen wir den 70. Jahrestag des Hitler-Stalin-Paktes und des Überfalls auf Polen, mit dem der Weltkrieg begann, vor zwanzig Jahren brach der Kommunismus in Ostmitteleuropa zusammen, vor fünf Jahren erweiterte sich die Europäische Union nach Osten. Die Jahrestage bieten Gelegenheit, einen kritischen Rückblick auf das grausamste Jahrhundert in der Geschichte Europas zu werfen, ein Jahrhundert, geprägt von zwei verheerenden Kriegen, die von Europa ausgingen, und zwei mörderischen Ideologien, die Hekatomben von Opfern forderten, das Jahrhundert von Auschwitz und Treblinka, aber auch des stalinistischen Gulags.
Was die düstere Vergangenheit angeht, so haben wir große Fortschritte gemacht. Wir sind den Nachbarn ein großes Stück näher gekommen und haben gelernt, offen mit ihnen zu reden. Die Geschichte nach 1945 hat gezeigt, dass die Europäer bereit sind, sich den Wirrungen der eigenen Vergangenheit zu stellen und die richtigen Lehren daraus zu ziehen. Und sie hat bewiesen, dass die Länder der anderen Seite Europas imstande sind, sich aus eigenen Kräften von der Bevormundung durch die Sowjetunion zu befreien.
Dieser Prozess ist schneller gekommen, als selbst die größten Optimisten zu hoffen wagten. Die Erweiterung des europäischen Einigungsprozesses nach Osten um jene Länder, die als Folge des Zweiten Weltkrieges unter den erstickenden Einfluss des stalinistischen Imperiums gerieten, ist ein Erfolg der europäischen Politik, der gar nicht hoch genug eingeschätzt werden kann. Umso schmerzlicher empfinden wir es, dass der Schwung dieses Prozesses in den letzten Jahren merklich nachgelassen hat.
Wo vorher die mitreißende Überzeugung war, sitzen jetzt nagende Zweifel. Nationale Egoismen machen sich breit, kleinkariertes, engherziges Denken. In manchen Ländern, nicht nur, aber auch in Ostmitteleuropa, erhalten minderheitenfeindliche Nationalismen Auftrieb, die manchen im Westen einen Vorwand liefern, erneut abzurücken vom Osten, der plötzlich wieder unberechenbar und bedrohlich erscheint.
Ich lebe im Südburgenland, nahe der ungarischen und slowenischen Grenze, die heute keine Bedeutung mehr hat. Und doch existiert sie immer noch. Jedenfalls in den Köpfen der Menschen. Zwischen dem Südburgenland und den angrenzenden ungarischen und slowenischen Regionen gibt es keinen regen Austausch, die Menschen, vor allem auf der österreichischen Seite, schielen skeptisch hinüber auf die andere Seite, die alten Ängste, das ehemalige Misstrauen sind immer noch da. Dabei gehörte das Burgenland vor 1918 nicht zur österreichischen, sondern zur ungarischen Reichshälfte der Österreichisch-Ungarischen Monarchie, es wächst also zusammen, was bis vor neunzig Jahren miteinander verbunden war. Doch von den einstigen Gemeinsamkeiten ist nicht mehr viel zu spüren, die historischen Fäden, die uns mit drüben verbanden, wurden längst abgeschnitten, neue werden nur zögerlich geknüpft.
Ähnlich ist das wohl auch anderswo in Europa. Darüber sollten wir uns nicht hinwegtäuschen. Es braucht viel Mühe und noch mehr Geduld, um bestehende Vorurteile abzubauen, um Ängste zu überwinden, um mit den Nachbarn wirklich ins Gespräch zu kommen, nicht anlässlich sorgfältig vorbereiteter Gedenkfeiern, bei denen schöne Reden geschwungen werden, sondern im Alltag.
Die politischen Ereignisse, so scheint es, haben in vielen Fällen das Denken der Menschen überholt, haben es hinter sich gelassen. In den Köpfen der Menschen finden Öffnungen und Erweiterungen scheinbar langsamer statt als in der Realpolitik, werden Grenzen, Mauern und Ängste langsamer abgebaut. Die Vorurteile und die Gleichgültigkeit gegenüber den Nachbarn, die sich gestern noch auf der anderen Seite befanden, sind manchmal schwerer zu überwinden als die trägsten politischen Systeme.
Vielleicht bin ich zu pessimistisch, das mag sein. Ich kann mich an eine Zeit erinnern, in der die Grenze zum anderen Europa ganz nah war, am anderen Ufer von Enns und Donau, der beiden oberösterreichischen Flüsse, die meine kindlichen Welt begrenzten. Heute ist diese Grenze weit nach Osten gerückt – aber sie existiert noch. Immer noch gibt es Länder und Völker in Europa, die scheinbar nicht dazu gehören, die außerhalb liegen, auf der anderen Seite, hinter einer neuen, virtuellen, jedoch scharf bewachten Mauer, die durch unseren Kontinent schneidet.
Ich denke dabei an die Ukraine. An die wunderbaren ukrainischen Autoren, die wir seit ein paar Jahren – beschämend spät – entdecken, an Juri Andruchowytsch, Oksana Zabuzhko, Andrei Kurkow, Jurko und Taras Prochasko, Serhij Zhadan, Natalka Snyadanko … jedes Jahr tauchen neue Namen auf, werden neue Titel übersetzt, und wir reiben uns verwundert die Augen und fragen uns, warum wir dieses Land, diese Literatur, diese Menschen so lange ignoriert haben? An ihnen lag das nicht. Sie gehörten schon immer zu Europa.
Ich denke dabei an Belarus, dieses nahe und doch so ferne und fremde Land. Manchmal hat es den Anschein, als würde ein Mantel des Schweigens über dieses Land gebreitet, nicht nur vom dortigen Machthaber, dem letzten Diktator Europas, sondern auch von unserer Seite. Aber vielleicht bin ich wirklich zu pessimistisch, und die neue Mauer, die Europa teilt, wird nicht lang Bestand haben. Das wünsche ich uns und unseren ukrainischen und belarussischen Freunden.
Martin Pollack ist Journalist, Schriftsteller und literarischer Übersetzer von polnischer Gegenwartsliteratur sowie Herausgeber zahlreicher Anthologien. Die Deutsch-Polnische Gesellschaft Bundesverband würdigte Martin Pollack in Anerkennung seines herausragenden Beitrags zur Verständigung zwischen dem polnischen und deutschsprachigen Leserkreis am 11. November 2017 mit dem diesjährigen DIALOG-Preis.
Der folgende Artikel erschien im Deutsch-Polnischen Magazin DIALOG Nr. 91.









