Deutschland steht vor Herausforderungen, für die die neue Regierung bisher kaum Vorsorge getroffen hat. Der Apparat regiert, ein Aufbruch bleibt aus.
Deutschlands bekanntester Dokumentarfilmer ließ sich die Chance nicht entgehen. Stephan Lamby, der mit Filmen über Henry Kissinger, Helmut Kohl, Wolfgang Schäuble, über die Euro-Krise, den Preis politischer Macht und zuletzt die Entfremdung von Politik und Öffentlichkeit Maßstäbe gesetzt hat, nahm sich nun des quälend langen Wegs zur Bildung einer neuen Bundesregierung an. „Im Labyrinth der Macht“ heißt sein neuer Film. Er lief Anfang März zur besten Sendezeit in der ARD und porträtiert ein Berliner Spitzenpersonal, das vor allem eines ist: müde.
Natürlich herrscht eine körperliche wie psychische Müdigkeit auch deshalb vor, weil Lamby uns teilhaben lässt an „dramatischen Nachtsitzungen“, an „üblen Vorwürfen und vielen Irrwegen“.
Lange nach diesem „Tag, der das Land verunsichert“, den Bundestagswahlen vom 24. September 2017, schien es so, als wollte niemand regieren, als wollte niemand außer der CDU und den Grünen Angela Merkel zur vierten Kanzlerschaft verhelfen. Christian Lindner, Parteichef der FDP, sprach nachts und im Regen aus, was zur Überschrift des ersten Kapitels dieser Regierungsbildung taugt: „Es ist besser, nicht zu regieren, als falsch zu regieren.“ Es war November geworden, es war an einem Sonntag, es war der Schlussstrich unter „Jamaika“, einem projektierten Bündnis aus CDU und CSU und FDP und Grünen.
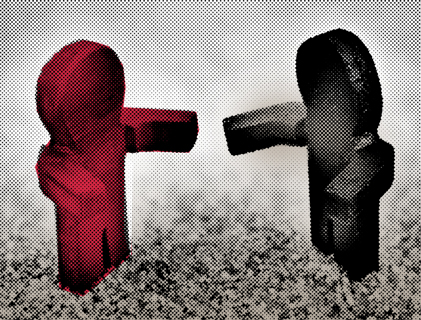
Müde lautete der vorherrschende Gemütszustand auch danach, zwischen Advent und Februar. Das zweite Kapitel auf dem mühsamen Weg, Deutschland zu einer Regierung zu verhelfen, stand im
Zeichen der SPD und unter der Überschrift: „Ich streb’ gar nix an.“ Der Satz lässt sich als totale Absage an jeden politischen Gestaltungswillen deuten, als angewandten Nihilismus, als
Kapitulationsurkunde im Schmollwinkel. All das ist der Satz, ausgesprochen vom damaligen SPD-Vorsitzenden und krachend gescheiterten Kanzlerkandidaten Martin Schulz. Das Zitat vom 26.
November 2017 lautet weiter: „Ich strebe keine Große Koalition an, ich strebe auch keine Minderheitsregierung an. Ich strebe keine Neuwahlen an. Ich streb’ gar nix an. Was ich anstrebe:
dass wir die Wege diskutieren, die die besten sind, um das Leben der Menschen jeden Tag ein Stück besser zu machen.“
Gerade darin aber war und blieb die SPD uneins: welche politischen Wege zu beschreiten sind; welche Maßnahmen welche Lebensverbesserung bei welchen Menschen bewirken sollen; ob ein
Vorsitzender mehr sein soll als ein Diskussionsleiter. Martin Schulz sah sich zu mehr nicht in der Lage. Sein Anfang Februar angekündigter Rücktritt vom Vorsitz war unausweichlich. Wer
unmittelbar nach den gescheiterten „Jamaika“-Verhandlungen trotzig wiederholt, dass die SPD für keine neue Große Koalition zur Verfügung stehe, und wer dann erklärt, mit ihm als Außenminister sei eine Große Koalition eine wunderbare Sache, der taugt für kein politisches Spitzenamt. Dass Schulz ein solches in Brüssel lange bekleidete, spricht gegen die Auswahlkriterien der EU-Eliten. Wie ungeschickt Schulz sich in Berlin aufführte, zeigt Lambys Film eindrücklich. Da redet ein jovialer Egomane sich launig um Kopf und Kragen, findet nicht den richtigen Ton, hat nicht die richtigen Konzepte, weiß zwischen Öffentlichkeit und Vertraulichkeit nicht zu unterscheiden. In Brüssel hat man ihn offenbar hofiert, in Berlin wird er gefordert. Wenn die künftige Justizministerin Katarina Barley (SPD) erklärt, nach dem Scheitern von „Jamaika“ hätte man „einfach erst mal ganz ruhig abwarten können, was die anderen vier Parteien zu ihrem eigenen Scheitern sagen“, fällt sie ein vernichtendes Urteil. Schulz, heißt das, ist kein politischer Kopf, sofern Politik die Schnittmenge meint des Machbaren mit dem Wünschbaren.
Müde ist Kevin Kühnert nicht. Fast im Alleingang setzte der 28-jährige Vorsitzende der „Jusos“, der „Arbeitsgemeinschaft der Jungsozialistinnen und Jungsozialisten in der SPD“, ein Mitgliedervotum durch. Eloquent und aufgeweckt warb er für den Gang in die Opposition. Obwohl im 177-seitigen Koalitionsvertrag von CDU, SPD und CSU sich die Handschrift der SPD an sehr vielen Stellen durchgesetzt hatte, traute Kühnert der Übereinkunft vom 7. Februar nicht. Seine Sorge, auf der Regierungsbank werde sich die SPD bis zur Unkenntlichkeit verschleißen, nahm man dem jungen Berliner ab. Ihn trieb die Befürchtung, eine neue Große Koalition wäre der endgültige Sargnagel auf einer Volkspartei namens SPD. Das dritte Kapitel auf dem Weg, Deutschland doch noch zu einer Regierung zu verhelfen, hatte deshalb die Überschrift: „Lass uns drüber reden!“
Die SPD bestätigte sich damit, je nach Blickwinkel, als quicklebendige, basisdemokratische Partei, oder aber als Selbsthilfegruppe mit masochistischer Ader. Verlass war in diesen Tagen einzig auf die fallenden Umfragewerte. Von den schon als Debakel empfundenen 20,5 Prozent bei der Bundestagswahl ging es herab in einen Bereich zwischen 15 und 17 Prozent. Bei einem Institut lag
man sogar knapp hinter der ungeliebten, ja verabscheuten Konkurrenz von der „Alternative für Deutschland“, die sich trotz eines fragwürdigen Spitzenpersonals und bedenklicher Äußerungen
anschickt, eine rechte Arbeiterpartei zu werden. Ob diese Gefahr jenen dämmert, die weiterhin das hohe Lied der Einwanderungsgesellschaft und des „humanitären Imperativs“ singen? Auch von
Kevin Kühnert sind keine migrationskritischen Äußerungen bekannt. Er zieht Steuererhöhungen dem Schutz der Grenzen vor. Ohne einen neuen Realismus in der Flüchtlingspolitik dürfte es die
SPD schwer haben, den Status der Volkspartei zurückzuerlangen. In weiten Teilen des Ostens ist sie es nicht mehr.
Die klare SPD-Mehrheit vom 4. März für eine Große Koalition – 66 Prozent stimmten für sie – ist nur auf den ersten Blick eine Niederlage für Kühnert. Er wird künftig unangefochten die Rolle des Parteigewissens innehaben. Bei allen Kompromissen, aus denen auch dieses Bündnis bestehen muss, wird sich die erste Frage nach deren Angemessenheit an ihn richten. Kühnert könnte, wenn er es geschickt anstellt, sich zum Gradmesser einer dezidiert linken Sozialdemokratie entwickeln. Dass diese im alltäglichen Handeln auf eine nach links gewendete CDU trifft, stillt die Sehnsucht nach der reinen sozialdemokratischen Lehre nicht.

Zwar gab es auf dem außerordentlichen Parteitag der CDU am 26. Februar erstaunlich laute Kritik am Links-Kurs unter Merkel. Die CDU gebe ihre konservative Stammklientel preis, hieß es, wenn sie den Zeitgeist mit Randthemen wie der „Ehe für alle“ bediene. Der Wirtschaftsrat gab tapfer zu Protokoll, mit dem Koalitionsvertrag werde der Staat weiter gemästet, die freie Wirtschaft aber ausgebremst – um dann in der Abstimmung mit wehenden Fahnen unterzugehen. Der Koalitionsvertrag wurde mit einer erdrückenden Mehrheit von 948:27 Stimmen gutgeheißen – von
berufenen Delegierten freilich, nicht, wie bei der SPD, von der Basis. Auch in krisenhafter Zeit ist auf die CDU als Machtmaschine Verlass. Dass die Felder Innere Sicherheit und Wirtschaft
tatsächlich vernachlässigt werden, fällt angesichts schwächelnder Konkurrenz und positiver ökonomischer Daten nicht entscheidend ins Gewicht, doch der Wind kann sich drehen. Die neue
Offenheit etwa, mit der über die Schattenseiten der Zuwanderung berichtet wird, über die Kosten für geringqualifizierte Männer aus dem islamischen Kulturraum und über die mit der Migration
gestiegene Kriminalität, könnte ein Wetterleuchten sein für Merkels Kanzlerschaft.
Insofern könnte es langfristig ein strategischer Fehler sein, dass Merkel weiterhin den Eindruck zulässt, ihr sei Europa wichtiger als Deutschland – obwohl sie unvermittelt auf dem Parteitag vom
„Schicksal unseres Vaterlands“ redete, um das sie sich kümmern werde. Der Koalitionsvertrag spricht eine andere Sprache. Er hat den langen Titel „Ein neuer Aufbruch für Europa. Eine neue
Dynamik für Deutschland. Ein neuer Zusammenhalt für unser Land.“ Europa steht an erster Stelle in einer Zeit, da sich Deutschland durch Merkels Migrationspolitik in Europa weitgehend isoliert hat. Die Kapitänin bekräftigt den Kurs, doch kaum jemand rudert in dieselbe Richtung.

Einstweilen ist die Schwäche der anderen das Glück von CDU und CSU. Eine ganze Legislaturperiode von vier Jahren dürfte dieses Glück freilich nicht tragen. Das neue Kabinett steht weniger für Aufbruch und Dynamik als für Beharrung. Die SPD, die sechs von 14 Ministern stellt,
versetzte Katarina Barley vom Arbeits- ins Justizressort, Heiko Maas vom Justiz- ins Außenamt. Dass aus einem überforderten Justizminister ein gewinnender Vertreter deutscher Interessen im Ausland wird, vermuten wenige. Auch das SPD-Urgestein Hubertus Heil verströmt als Arbeitsminister keinen Geist des Neuanfangs. Einziger Coup ist Franziska Giffey, Bürgermeisterin von Neukölln, als neue Familienministerin. Die resolute Frau hat in einem Berliner Problembezirk nachgewiesen, sich von den Herausforderungen einer Multikulti-Gesellschaft nicht den Schneid abkaufen zu lassen.
Die CDU beließ die chronisch erfolglose Ursula von der Leyen an der Spitze der Bundeswehr, ernannte mit Anja Karliczek eine Hotelfachfrau zur Bildungsministerin und band mit Jens Spahn als
Gesundheitsminister einen tatsächlichen oder vermeintlichen Merkel-Kritiker in die Kabinettsdisziplin mit ein. Immerhin gibt der 37-Jährige weiterhin Interviews, in denen er erklärt:
„Es geht auch darum, kulturelle Sicherheit zu erhalten: Bräuche, Traditionen, der freie Sonntag. Wir sollten Tugenden wie Fleiß oder Pünktlichkeit aktiv wertschätzen.“ Im bundesweit
wahrgenommenen Streit um die Essener „Tafel“, die Lebensmittel an Bedürftige ausgibt und nach schlechten Erfahrungen mit rüpelhaften Migranten vorerst keine neuen Ausländer aufnimmt, zeigt er Verständnis für die Maßnahme. Dort seien „junge Männer dreist und robust“ aufgetreten. Kein Frühling ohne Frühjahrsmüdigkeit. Hausärzte kennen den Zusammenhang und verweisen auf den nahenden Sommer. Ob Deutschlands Politik ihre Müdigkeit ebenso rasch überwinden wird? Einstweilen herrscht in der noch fast besten aller ökonomischen Welten eine große Zukunftsscheu. Das Kabinett ist ein Ensemble mehr oder minder vertrauter Parteiköpfe. Überraschende Fachleute, vielleicht gar aus einem politikfernen Umfeld, sucht man vergebens. Proporz schlägt Expertise, der Apparat regiert. Über die Halbwertszeit der vermutlich letzten Merkel-Regierung wird einerseits die ökonomische Lage entscheiden, andererseits das Management der unverändert gewünschten Migration. Auf beiden Feldern wurde wenig Vorsorge getroffen für schlechte Zeiten. So steht denn als Motto über dem ersten Kapitel der am 14. März vereidigten Regierung eine alte deutsche Redensart: „Es wird schon schiefgehen!“








