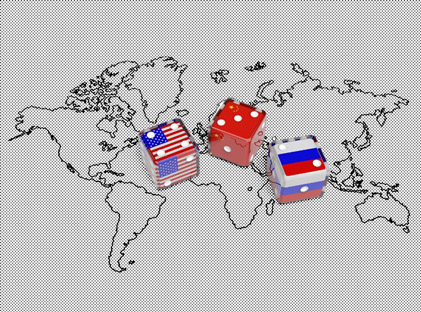An den Anfang dieser Geschichte wollen wir einmal eine Zahlenreihe setzen: 268; 226,9; 273; 295,2; 315,1; 318,7; 344,8; 367,3; 347; 375,6. Dies sind weder Telefonnummern noch Lottogewinnzahlen, sondern die offiziellen Daten des US-Amts für Statistik zur Entwicklung des Handelsdefizits mit China in Milliarden US-Dollar von 2008 bis 2017. Wie ersichtlich, wächst das Defizit stetig, und 2018 beträgt es bisher jeden Monat etwa 30 Milliarden US-Dollar. Das Defizit lag 2017 bei über der Hälfte des jährlichen Bruttoinlandsprodukts (BIP) von Polen, was man sich vor Augen führen sollte, um zu begreifen, welche Einsätze hier auf dem Spiel stehen.
So wird es keinesfalls weitergehen, schließlich verzichtet keine Großmacht freiwillig auf ihren hegemonialen Status. Daher hat auch jeder US-Präsident, nicht nur der (um es einmal zurückhaltend auszudrücken) unkonventionelle Donald Trump, es mit einem schwierigen Problem zu tun: Wie soll man mit dem rasch an Stärke und Bedeutung gewinnenden China umgehen?
Bekanntlich hat Trump Twitter zu seinem bevorzugten Instrument zur Verkündung (und auf Druck seiner eigenen Administration auch zu ihrer Widerrufung) von politischen Entscheidungen und Einschätzungen gemacht. In einigen davon verlautbarte er, und zwar ohne späteren Widerruf: Beim Umgang mit China gehe es nicht allein um ein ungeheuer hohes Handelsdefizit, sondern auch um einen auf 300 Milliarden Dollar jährlich geschätzten Diebstahl amerikanischer Urheberrechte und die Übernahme amerikanischen Know-hows.
Ein neuer Kaiser zieht wider die Große Mauer
Diese insgesamt kaum widerlegbaren Daten und Fakten drängen zu geostrategischen Überlegungen. Dazu gehören noch zwei weitere Problembereiche, die nicht allein Trump, sondern die gesamte US-Führung in Alarmzustand versetzt haben. Zum einen die von Peking 2015 verkündete Strategie „Made in China 2015“, in Analogie zur deutschen (und nicht amerikanischen) Agenda „Industrie 4.0“. Ihr Ziel ist, China nicht zu einer Wirtschafts‑ und Handelsmacht zu machen, was es längst ist, sondern darüber hinaus in zu einem Innovations‑ und Technologiepionier, der nicht auf Import angewiesen ist und sich auf eigene Findigkeit und Unternehmertum verlassen kann. Und zweitens: Der zur Zeit mächtige Mann in Peking mit Ambitionen auf den Namen eines „neuen Kaisers“ und die Einmannherrschaft, Xi Jinping, präsentierte im Herbst 2013, kaum ein Jahr nach Amtsantritt, seine „Belt and Road Initiative“ (BRI, bis 2016 „One Belt and One Road Initiative“, OBOR), das heißt in Anklang an das chinesische Altertum zwei neue Seidenstraßen, zu Lande und zu Wasser, die dem immer expansiveren China den Weg in die Außenwelt öffnen sollen, vor allem in den Westen.


Beide Straßen führen Richtung Europa: Der Seeweg endet vorläufig am Athener Hafen Piräus, kann aber möglicherweise bis Venedig verlängert werden, der Landweg führt über Kasachstan, Russland, Belarus und Polen gen Hamburg und Rotterdam. Zu welchem Zweck? Wiederum gibt es zwei Hauptgründe: weil das entwickelte Europa und insbesondere die Europäische Union Chancen auf Fusionen und Übernahmen besonders bei führender Technologie bieten. Darüber hinaus vollzog China 2014 eine wahrhaft kopernikanische Wende: Das dorthin gelangende Kapital und die Auslandsinvestitionen, die wegen des riesigen Marktes immer schon hoch waren, wurden erstmals von dem aus China abfließenden Kapital übertroffen. Das Reich der Mitte wurde zum Exporteur nicht nur von Waren und Dienstleistungen, sondern auch von Kapital.
So begann das Land, das sich bis vor kurzem selbst als „größter aufsteigender Markt der Welt“ bezeichnete, in Europa und der EU zu investieren, das heißt in der seit langem als „Erste Welt“ definierten Region, und noch dazu das Familiensilber aufzukaufen. Ein Beispiel dafür ist die Übernahme des schweizerischen Chemiegiganten Syngent durch das chinesische Staatskonsortium ChemChina. Im Frühjahr 2017 kaufte dieses einen Aktienanteil von 96 Prozent der Schweizer Firma für die hübsche Summe von 43 Milliarden US-Dollar. Kurz zuvor hatte bereits das chinesische Unternehmen Midea für 4,5 Milliarden Euro 94,5 Prozent der Aktien der deutschen Firma Kuka übernommen, deren Spezialgebiet Industrieroboter sind.
Das waren schon Warnhinweise darauf, dass die Sache allmählich ernst wurde, weil die Chinesen nicht mehr allein schicke Hotels in Montenegro oder in Prag kauften, berühmte Fußballclubs wie den AC Mailand, sondern auch geschichtsträchtige Unternehmen wie Volvo und Pirelli in der EU oder den großen Lebensmittelkonzern Smithfield Foods in den USA (und damit auch dessen polnische Tochter Animex). Darüber hinaus setzen einige US-Firmen wie General Electric oder Qualcom in China den Großteil ihrer Produkte ab, und einige, von Apple angefangen, lassen einen Großteil dort produzieren. Übrigens kommt Qualcomm dieses chinesische Engagement möglicherweise teuer zu stehen, nämlich bis zu 44 Milliarden Dollar, weil die Firma mit dem bisherigen Rivalen, der niederländischen Firme NXP, und nicht mit den Chinesen fusionieren möchte.
Die wechselseitigen Abhängigkeiten sind also ganz unterschiedlicher Art, aber zusammengenommen belegen sie eines: Die Abhängigkeit des Westens von dem riesigen chinesischen Markt ist sehr groß, und es wird nicht einfach sein, sich davon zu befreien.
Kapitalisten hinter der Mauer und Freihandelskommunisten
Wo doch Xi Jinping bereits wenigstens zweimal in aufsehenerregender Weise, nämlich im Januar 2017 auf dem bekannten Davoser Wirtschaftsforum und im April 2018 auf dem hierzulande weniger bekannten, aber für China und die ganze Region noch wichtigeren Wirtschaftsforum von Boao auf der Insel Hajnan gleichsam als Antwort auf Trumps isolationistische Formel „America First“ zu verstehen gegeben hat, dass China, nominell immer noch ein kommunistisches Land, weiterhin auf Globalisierung, offene Märkte und wirtschaftliche Verflechtung setze. Einmal mehr bestätigt sich damit, was bereits während der Expansion der großen Imperialmächte bewiesen wurde, also der Briten im 19. Jahrhundert und dann der USA, dass nämlich eine aufsteigende Großmacht immer größere Gebiete, Flächen und Bereiche für ihre Expansion benötigt.


Der Beweis dafür ist im Falle von China das BRI-Konzept, das bis heute nicht so recht klar dargelegt und präzisiert wurde, was die Größenordnung, den Aufgabenbereich und die Geographie anbelangt. Dieses Manko gleicht es durch starke Propagandawirkung aus. Auf dem ersten der im zweijährigen Rhythmus geplanten BRI-Gipfel in Peking vom Mai 2017 hieß es, das Projekt umfasse bereits 65 Staaten (inzwischen sind es 70) und die dafür angewiesenen Summen könnten nicht weniger als 1,3 Billionen Dollar betragen. Das ist mit anderen Worten das Zehnfache dessen, was die Amerikaner nach dem Zweiten Weltkrieg für den Marshallplan aufwandten. Ohne Zweifel haben wir es hier mit einer neuen chinesischen Herausforderung zu tun.
Donald Trumps Reaktion ließ nicht auf sich warten. Er kündigte zusätzliche Zölle auf Stahl‑ und Aluminiumprodukte an und führte sie dann auch ein. Die ersten Salven des Handelskriegs wurden abgefeuert, Verlauf und Folgen sind schwer abzuschätzen. Außer einer: Wenn sich die beiden stärksten Wirtschaftsmächte der Welt schlagen, wird es keinen Sieger geben.
Denn Trump teilte nicht nur gegen die Chinesen aus, sondern auch gegen befreundete Nachbarländer und Partnerstaaten im Rahmen von NAFTA, also Kanadier und Mexikaner, und auch gegen die EU, insbesondere Deutschland, dessen umfassender Pkw-Export auf den US-Markt ihm ein Dorn im Auge ist. Im Verhältnis zwischen USA und EU ist es vorerst gelungen, dank der erfolgreichen Washingtoner Visite des Präsidenten der Europäischen Kommission Jean-Claude Juncker Ende Juli einen Waffenstillstand zu vereinbaren. Doch sind politische Beobachter weiterhin skeptisch. Nur wenige glauben an einen Durchbruch auf Dauer. Schwer vorauszusagen, ob das Kriegsbeil endgültig begraben werden kann, zumal weder in Washington noch in Brüssel oder Berlin von einer Rückkehr zu TTIP, dem großen transatlantischen Abkommen über Handel und Investitionen, die Rede ist. Mit einer neuen Konjunktur des transatlantischen Handels ist eher nicht zu rechnen. Es ist nicht die Zeit offener Märkte, sondern die Zeit für die isolationistische Parole „America First“ und neuer Handelsschranken und Mauern.
Chinesische Ziele, globale Folgen
Die Chinesen reagieren entschlossen, befürchten aber weitere amerikanische Maßnahmen. Aus ganz egoistischen und innenpolitisch motivierten Gründen. Denn Xi Jinping verkündete Ende 2014 auch, unter seiner Leitung werde das Land gemäß seinem zweiten Plan „zwei Jahrhundertziele“ verfolgen. Das erste ist bis Mitte 2021 zu erreichen, zum 100. Jahrestag der Gründung der Kommunistischen Partei Chinas; es handelt sich um nichts Geringeres als den Aufbau von xiaokang shehui, das heißt der „Gesellschaft gemäßigten Wohlstands“. Das Land soll sich dabei weg vom Export und hin zu einer entwickelten, wohlhabenden Mittelklasse orientieren. Das ist keine leichte Aufgabe, denn auf dem Weg dorthin ist die vermutlich schwerste Reformhürde zu nehmen, nämlich der Übergang von Quantität zu Qualität.
Daraufhin soll ein noch ehrgeizigeres Ziel erreicht werden, und zwar zum 100. Jahrestag der Ausrufung der Volksrepublik China, der auf den 1. Oktober 2049 fallen wird. Für dieses Datum ist geplant, den „chinesischen Traum“ (Zhongguo meng) zu erfüllen, der die Gestalt einer „großen Renaissance der chinesischen Nation“ annehmen soll, der dritten der chinesischen Geschichte nach denen zur Zeit der Han-Dynastie um die Zeitenwende und der Tang-Dynastie im 9. Jahrhundert.
Doch wird es keine Renaissance geben, wenn das Land, so wie es Peking sieht, weiterhin geteilt ist. Denn Fakt ist, dass es seit 1949 zwei Staaten mit dem Namen China gibt, die Volksrepublik China und die Chinesische Republik Taiwan. Anders gesagt, unbedingte Voraussetzung für die groß angekündigte chinesische Renaissance ist die friedliche Vereinigung mit Taiwan; eine militärische könnte dagegen katastrophale Folgen haben.
Bereits der Anschluss Hongkongs an den chinesischen Blutkreislauf im Juli 1997 war für die chinesische Wirtschaft enorm belebend, umso mehr wäre es der Anschluss Taiwans, was im Übrigen aufgrund des bilateralen Economic Cooperation Framework Agreement (ECFA) von 2010 gewissermaßen bereits geschehen ist. Taiwan hat zwar nur 23 Millionen Einwohner, sein BIP gleicht jedoch ungefähr dem polnischen. Der Anschluss würde China automatisch zum größten Wirtschaftsakteur der Welt machen.


Deshalb legt Peking so großen Wert auf das Verhältnis zu den USA. Große Verdienste darum hat Vizepräsident Wang Qishan, wie auch der in diesem Jahr zum „Zaren der chinesischen Wirtschaft“ gekürte Vizepremier Liu He, der sehr umfassende Vollmachten besitzt. Beide verfügen über einen in der chinesischen Politik unschätzbaren Vorzug – sie stehen seit langem Xi Jinping nahe und besitzen sein Vertrauen. Beide sprechen englisch, Liu He hat gar ein Diplom der Harvard University. Die modernen Mandarine in Peking sind bestens vorbereitet und wissen ganz genau, was sie wollen. Und der Westen?
Hier haben wir bekanntlich ein Problem. Die EU ist vollauf mit schweren Krisen und Erschütterungen beschäftigt, die USA werden von einem Präsidenten geführt, der nach allgemeinem Konsens als unberechenbar gilt, mit der Folge, dass selbst die transatlantischen Beziehungen und die NATO auf der Kippe stehen. Der Kreml kann darüber seine Freude kaum verhehlen, und auch darin besteht Konsens. Und welches Spiel spielen die Chinesen? An einer Spaltung der EU und Aushöhlung ihrer Bedeutung ist ihnen eher nicht gelegen. Sie geben klar zu verstehen, dass sie einen dritten Läufer brauchen, bei ihren schwierigen und fortdauernd angespannten Beziehungen zu den USA. Wobei nach ihrem nüchternen Kalkül diese Rolle nicht von dem mit dem Westen über Kreuz liegenden Moskau übernommen werden kann.
Daher bedarf es keiner weiteren Erklärung, wieso Ministerpräsident Li Keqiang auf dem letzten Jahresgipfel EU-China beinahe offen den Vorschlag machte, sich gemeinsam dem amerikanischen Vorhaben zu widersetzen, in der Handelspolitik den Weg in den Isolationismus zu beschreiten. Bekanntlich haben die europäischen Institutionen, angefangen mit der Kommission, nicht angebissen. Doch die Chinesen sind beharrlich und werden ihre Vorschläge sicher erneuern.
Beleg dafür ist eine weitere in Europa vorgebrachte chinesische Initiative, nämlich die von Peking erdachte 16+1-Kooperation. Bei dieser sollen die Länder Ostmitteleuropas vom Baltikum über die Visegrád-Staaten bis zum Balkan unabhängig von ihrer EU-Zugehörigkeit und allein mit Blick auf ihre kommunistische Vergangenheit zusammengebracht werden. Diese Initiative ging noch auf die vorherige chinesische Regierung zurück und wurde im April 2012 von dem damaligen Ministerpräsidenten Wen Jiabao in Warschau vorgebracht. Sie hat seither in der Schwebe gehangen und bislang keine konkreten Ergebnisse hervorgebracht. Und was meinen die Chinesen dazu? Unlängst schlugen sie wenn auch inoffiziell vor, Deutschland in diese Kooperation einzubeziehen, weil sie sich im Klaren sind, dass sie mit der 16+1-Kooperation in deutsches Einflussgebiet hineinwirken. Sie wollen die Kooperation, weil der wahre Rivale und Herausforderer nach wie vor die USA bleiben.
Eine neue zerstrittene Welt?
In Peking setzt man nicht sonderlich auf die BRICS-Gruppe, zu der Russland gehört, trotz anderslautender offizieller Erklärungen. Schließlich wissen die Chinesen, dass sie allein ein größeres BIP und Handelsvolumen produzieren als die übrigens vier BRICS-Partner zusammengenommen, nämlich Indien, Russland, Brasilien und Südafrika. Zudem sind die Inder immer nervöser wegen der chinesischen Expansion in den Indischen Ozean, also in ihrer traditionellen Einflusssphäre.
Was ist daraus zu schließen? Wie wird die neue Weltordnung aussehen? Ohne Rücksicht auf Verlauf und Folgen des Fahrt aufnehmenden Handelskriegs, sieht es danach aus, dass das von seiner Großen Renaissance träumende China seine unter dem Namen tian xia bekannte, traditionelle Ordnung forcieren wird, wobei es sich auf die Überzeugung stützt, inmitten eines Kranzes von Tributärstaaten eine zentrale zivilisatorische Führungsrolle zu spielen. Andererseits entsteht in Opposition gerade gegen China die indopazifische Konzeption, welche die USA und das mit ihm verbündete Japan einschließt, ebenso wie Indien und möglicherweise Australien, das allerdings zögert, weil es wirtschaftlich stark mit China verschränkt ist.
Wo wird in dieser Weltordnung die EU ihren Platz finden? Noch vor kurzem hätten wir gesagt: Im Westen. Aber was heißt heute schon noch „der Westen“? Wo bleibt seine Geschlossenheit, Solidarität und Strategie? Daher kann aus diesen Überlegungen nur ein Schluss gezogen werden: Wir werden als EU kein Machtzentrum bilden, wenn wir unsere Beziehungen zu den USA nicht auf eine neue Grundlage stellen und keine eigene, geschlossene Strategie gegenüber China, Indien und den aufsteigenden Märkten entwickeln. Nach der Krise von 2008 hat sich die Welt gründlich verändert und verändert sich weiterhin. Daraus sind baldmöglichst Schlüsse zu ziehen. Denn alles wird anders sein, als es einmal war.
Aus dem Polnischen von Andreas R. Hofmann