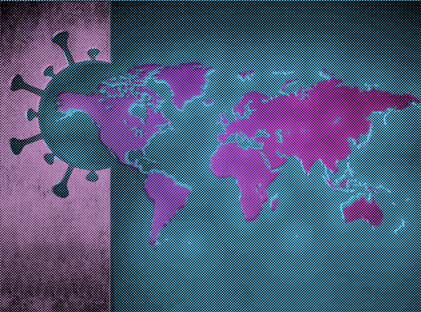Deutschland ringt um die Zukunft seiner Energie- und Umweltpolitik
Ein Waldstück nahe Köln ist seit vergangenem Herbst das Symbol deutscher Energiepolitik. Der gerade einmal 200 Hektar große Hambacher Forst liegt am Rande des größten Tagebaus des Rheinischen Braunkohlereviers – und seine Bäume sind ein bundesweites Politikum.
Berühmt wurde der Forst erst durch seine Rettung: Die Braunkohle unter dem Waldstück solle „im Boden bleiben“, forderten Klimaaktivisten. Im Oktober stoppten sie schließlich nach spektakulären Baumbesetzungen die Rodung mit einem Eilantrag vor dem Oberverwaltungsgericht in Münster. Daraufhin gab es am Hambacher Forst volksfestartige Demonstrationen – es kamen 50.000 Menschen aus Deutschland und Europa: „RWE kann einpacken“, feierten die Aktivisten ihren Teilsieg gegen den Energiekonzern.
Drei Wochen später bot sich ganz in der Nähe des famosen Forstes ein ganz anders Bild. Mit Trillerpfeifen und Bergmannshelmen demonstrieren tausende Kohlekumpel im beschaulichen Bergheim bei Köln für ihre Arbeitsplätze. Aufgerufen hatten zu der Demonstration die Industriegewerkschaft Bergbau, Chemie, Energie (IG BCE) und die Gewerkschaft Verdi. “Die Beschäftigten sind es leid, dass die Klimadebatte auf ihrem Rücken ausgetragen wird”, ließ sich IG-BCE-Chef Michael Vassiliadis im Aufruf zitieren. Immer wieder würden Arbeitsplätze “durch leichtfertige Abschaltpläne in Gefahr gebracht”.
Mit Slogans wie “I love RWE und deren Familien” oder “Für Rechtsstaat und sicheren Strom” unterstützen die Arbeiter ihre Unternehmen, vorrangig die Kohlekonzerne RWE und Leag in der Lausitz. Wenig nette Worte hatten einige Demonstranten für die Umweltschützer im Hambacher Forst übrig: “Aktivisten im Hambacher Forst: Reichsbürger mit Rastas”, heißt es auf Schildern oder “Grüne = ideologischer Irrsinn”.

Der Kampf für und gegen den Ausstieg aus der Kohle spaltet Deutschland: Es steht die alte gegen die neue Generation, das 20. gegen das 21. Jahrhundert. Mittlerweile erhielt die Klimaaktivisten-Bewegung auch Rückendeckung von hunderttausenden Schülern und Studenten, die weltweit bei den Schulstreiks „Fridays for Future“ für mehr Klimaschutz auf die Straßen gehen. In Berlin stehen sie jede Woche am Brandenburger Tor oder am Invalidenpark vor dem Wirtschaftsministerium und machen Druck auf die deutsche Regierung für den Ausstieg aus fossilen Energien. Die Klimapolitik der Regierung ist ihnen zu langsam, die Kompromisse mit den Kohlekonzernen zu lasch. Die Fridays-for-Future-Demonstranten sind das komplette Gegenteil der meist älteren und männlichen Kohlekumpel und Gewerkschaftler, die ihr gesamtes Leben mit der Kohle verbracht haben. Die Jungen halten die alte „fossile Garde“ für verantwortungslos. Und die Alten halten die Kinder und Klimaaktivisten für naiv und ideologisch. Beide Seiten sind unversöhnlich.
Natürlich wissen auch die Verteidiger der Kohle, dass es auf längere Sicht keine Zukunft für ihre Energieform gibt. Das fossile Wirtschaftsmodell läuft aus. Das ist keine verrückte „Ökoidee“ mehr, sondern politischer Mainstream und steht – von ganz links bis rechts – in jedem Parteiprogramm.
Teure Versäumnisse in der Energiepolitik: Nicht Fisch, nicht Fleisch
Doch die Fronten sind verhärtet. Es geht darum, wie der Übergang in ein dekarbonisiertes Zeitalter organisiert wird. Es geht um den Fahrplan, um die Ziele des UN-Weltklimavertrags zu erreichen, den Deutschland gemeinsam mit 194 anderen Staaten unterstützt. Bis 2050 muss Deutschland seinen CO2-Fußabdruck um 80 bis 95 Prozent senken – und das in allen Bereichen. Es reicht nicht, überall ein paar Windräder und Solarpanels zu installieren, vielmehr muss die gesamte Infrastruktur umgebaut werden: von der Stromerzeugung über den Verkehr bis hin zum Heizen von Gebäuden und der Landwirtschaft. Es geht darum, die Erderwärmung auf 1,5 oder maximal zwei Grad zu verhindern. Aber es geht gleichzeitig auch um Milliarden, um Blackouts und Arbeitsplätze, um Verlustangst und das Ausbluten abgehängter Regionen.
Besonders schmerzhaft bekommt Deutschland nun das jahrelange Zögern und Nichtstun in Sachen Klimaschutz zu spüren: Seit zehn Jahren sinken die CO2-Emissionen praktisch nicht. Das Land leistet es sich momentan, selbstgesteckte Klimaziele zu vertagen – ein fatales Signal, das so einfach nicht länger anhalten darf. Die letzte Frist ist spätestens 2030 endgültig vorbei – das sind noch gut zehn Jahre für einen gigantischen Umbau. Wie alle Länder muss nun auch Deutschland bis dahin endlich Farbe bekennen. Der Verkehr muss elektrisiert, die Wärme erneuerbar und die Landwirtschaft CO2-freundlich gemacht werden. In den meisten Bereichen ist bisher außer einer Reihe kluger Strategiepapiere fast gar nichts geschehen.
Einzig im Stromsektor glänzt Deutschland mit einem Anteil von über 30 Prozent Erneuerbaren. Der Zuwachs an sauberer Energie wird aber derzeit nicht durch die Abschaltung von fossilem Strom ausgeglichen. So kommt es zu enormen Stromüberschüssen, die die Stromtrassen verstopfen und in die Nachbarländer verscherbelt werden. Die Patt-Situation ist das Ergebnis der deutschen Unentschlossenheit: Das deutsche Energiesystem ist weder Fisch noch Fleisch.
Selbst der Bundesrechnungshof stellt der Regierung ein vernichtendes Urteil aus: 160 Milliarden Euro hätte das Wirtschaftsministerium in den vergangenen fünf Jahren für die Energiewende ausgegeben – das stehe in keinem Verhältnis zu den Ergebnissen, so der Präsident des Bundesrechnungshofes Kay Scheller. „Derzeit gibt es kein anderes Einzelunterfangen der Bundesregierung, das diese finanzielle Größenordnung erreicht.“ Es drohe „das Risiko eines Vertrauensverlustes in die Fähigkeit von Regierungshandeln“, glaubt Scheller.
Es hapert an einer entschlossenen Umsetzung – das zeigen auch die Zahlen der Bundesnetzagentur. Demnach sind von den bundesweit 7.700 Kilometern neuer Stromnetze derzeit erst 1.750 Kilometer genehmigt. Davon wiederum wurde nur etwas mehr als die Hälfte tatsächlich gebaut. Ohne ausgebaute Netze kann die Energiewende aber nicht gelingen. Während im Norden und auch in Teilen Ostdeutschlands die Erneuerbaren boomen und sie ihren Strom nicht loswerden, droht im Süden der Engpass, wenn dort die letzten Atomkraftwerke und dann auch die Kohlekraftwerke vom Netz gehen.
Dass Deutschland schon seit Jahren kein Klimavorreiter mehr ist, hat auch ein fatales Echo in der internationalen Gemeinschaft: Nur noch auf Platz 27 von 57 Industrie- und Schwellenländern liegt Deutschland laut dem Klimaschutz-Index des Climate Action Networks, weit hinter Staaten wie Schweden und Marokko.
Der vergoldete Kohleausstieg
Als die deutsche Regierung 2011 den Ausstieg aus der Atomkraft beschloss, war die Aufregung groß. Am Ende jedoch besänftigte Bundeskanzlerin Angela Merkel die Betreiber mit Milliardenentschädigungen und die atomskeptische Öffentlichkeit mit dem ehrgeizigen Fahrplan, bis 2022 alle Atomkraftwerke vom Netz zu nehmen.
Acht Jahre später steht Deutschland vor dem nächsten großen Ausstieg. Dieses Mal geht es um eine Energieform mit über 200-jähriger Tradition: Kohle. Über 30 Prozent des deutschen Stroms kommen aus Braun- und Steinkohlekraftwerken. Rechnet man beide Ausstiege zusammen, muss über die Hälfte der inländischen Stromerzeugung in den nächsten Jahrzehnten komplett ausgetauscht und durch erneuerbare Energien oder Gasimporte ersetzt werden. Gleichzeitig muss Energie gespart werden – unter anderem mit sogenannten intelligenten Netzen und „Smart-Metern“, die für einen ausgewogeneren Stromverbrauch sorgen.
Da die Abwicklung der klimaschädlichen Kohle die deutsche Öffentlichkeit spaltet und hinter der Kohle nicht nur die Betreiber, sondern auch Gewerkschaften stehen, zudem Parteitraditionen berührt werden – allen voran die der Sozialdemokraten – und die Regierung bei dem Thema tief zerstritten war, lagerte man die Aufgabe in ein zivilgesellschaftliches Gremium aus. Mitte 2018 berief man die Kommission “Wachstum, Strukturwandel und Beschäftigung” ein, die aus Vertretern der Politik, Energiewirtschaft, Umweltbewegung, Wissenschaft und Gewerkschaften zusammengesetzt ist.
Ende Januar legte diese nun einen Abschlussbericht vor und empfahl der Bundesregierung einen Fahrplan für den klima- und sozialverträglichen Kohleausstieg: Demnach hat Deutschland rund 20 Jahre Zeit, um die Kohle komplett aus der Energiewirtschaft zu verabschieden. So sollen keine neuen Kohlekraftwerke und Tagebauerweiterungen mehr genehmigt werden und schon bis 2022 knapp 5.000 Megawatt Braunkohle und 7.700 Megawatt Steinkohle reduziert werden. Bis 2030 soll die aktive Kohleleistung – ohne Reserven – auf maximal 9.000 Megawatt Braunkohle und 8.000 Megawatt Steinkohle schrumpfen, um dann bis 2038 den Rest der Kraftwerke abzuschalten. Umweltschützern ist das nicht ehrgeizig genug und auch die junge Fridays-for-Future-Bewegung fordert, das Ende der Kohle auf 2030 vorzuverlegen.

Die Kommission, so argumentiert die Bundesregierung, hat jedoch in einem demokratischen Verfahren getagt und als Kompromiss 2038 ausgehandelt. Daran werde man sich nun halten. Um das umzusetzen, arbeitet die Regierung derzeit an einem Kohleausstiegsgesetz. Doch das Thema Kohle bleibt kompliziert: Schon die erste Deadline Ende April wird die Regierung voraussichtlich nicht einhalten. Ein Zankapfel sind die Beihilfen für den Strukturwandel. Denn der Staat hat sich verpflichtet, die betroffenen Kohleregionen auszubezahlen. Doch nicht nur die Braunkohle-Regionen, sondern auch die Steinkohle-Länder wollen nun ihren Teil vom Kuchen bekommen – dafür setzen sich vor allem die Sozialdemokraten ein.
Die Kohle-Regionen klagen über Landflucht und „Deindustrialisierung“. Deshalb sollen in den nächsten zwanzig Jahren für den durch den Kohleausstieg verursachten Strukturwandel 40 Milliarden Euro fließen – allerdings aus dem laufenden Haushalt. Bei dem ersten Sofortprogramm von 260 Millionen Euro, was die Regierung bereits auflegte, geht es auch um Maßnahmen, die weder mit der Energiewende noch mit dem Kohleausstieg etwas zu tun haben, wie beispielsweise um ein besseres Internet oder den Bau von Straßen und Schienenstrecken. Umweltschützer und auch einige Mitglieder der Kohlekommission hätten es gern gesehen, wenn die finanzielle Unterstützung für die Kohle-Länder direkt an Klimaschutzerfolge gekoppelt worden wäre. Doch das ist nicht passiert. Umweltschützer und die Grünen im Bundestag fürchten zudem, dass Milliarden Steuergelder als Entschädigung in die Kassen von RWE, Steag oder Leag fließen könnten.
Immerhin hat es das kleine Waldstück bei Köln, der Hambacher Forst, in die Empfehlungen der Kohle-Kommission geschafft: Dessen Erhaltung hält die Kommission für “wünschenswert” und “bittet die Landesregierungen, mit den Betroffenen vor Ort in einen Dialog um die Umsiedlungen zu treten, um soziale und wirtschaftliche Härten zu vermeiden”. Dennoch gilt der Rodungsstopp nur bis 2020. Dann könnten die Bagger erneut rollen und der Konflikt von vorn beginnen.