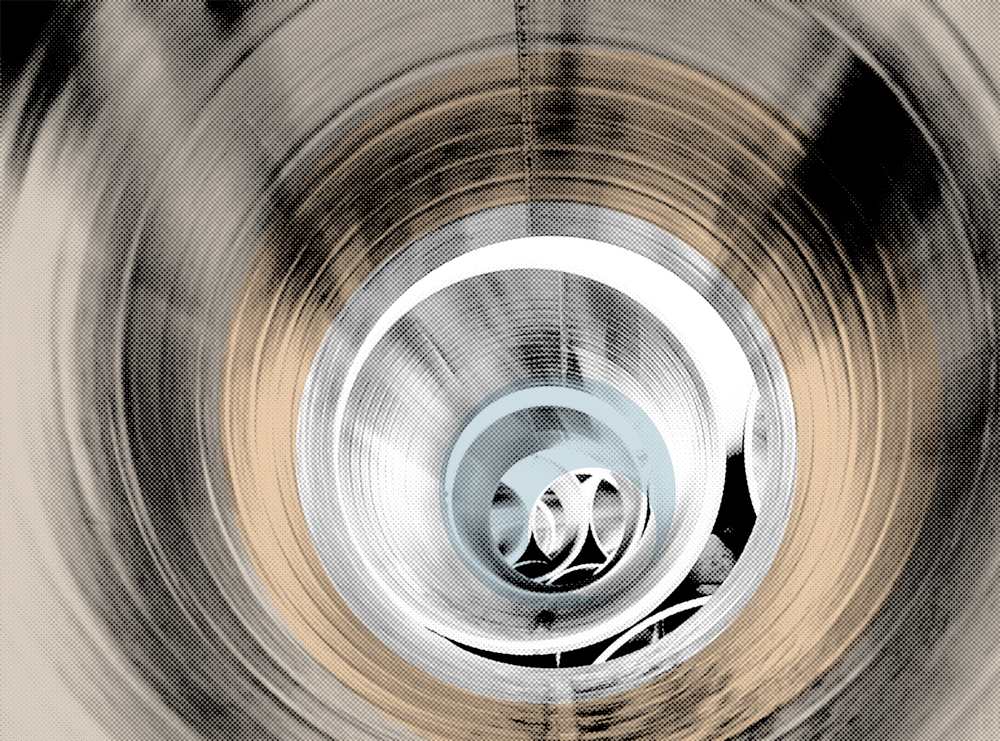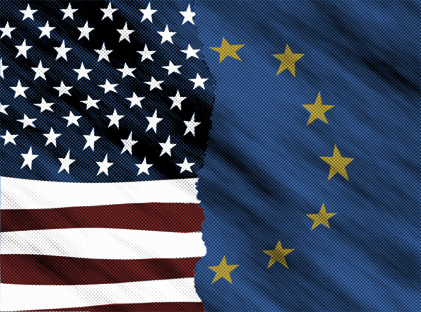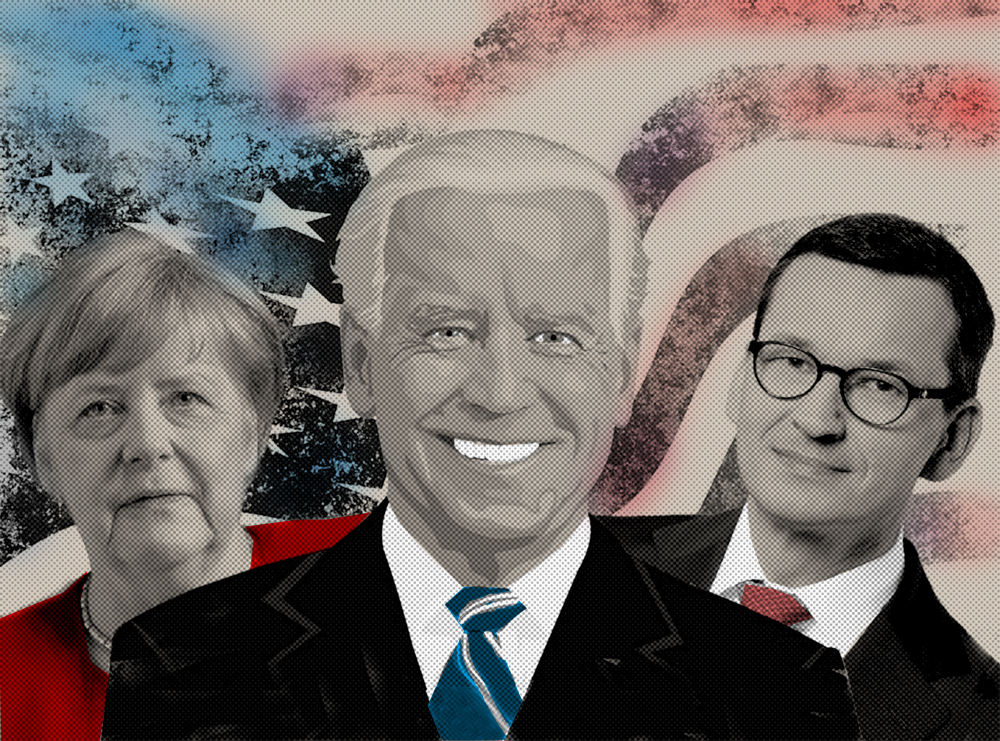“Die Berichte über mein Ableben sind stark übertrieben” – Mark Twain
Wenn sogar die Münchner Sicherheitskonferenz, dieses jährliche Pfadfindertreffen der Rechtschaffenen (und einiger Autokraten), von „Westlessness“ spricht, dann muss es schon schlimm bestellt sein um das Abendland. Und tatsächlich: Im Zeitalter von Trump und Putin, von transatlantischen Spannungen und chinesischem Auftrumpfen, von autoritären Tendenzen selbst innerhalb der EU, fällt es schwer, noch an eine positive Zukunft des Westens zu glauben. 1989, diese Sternstunde der Freiheit, ist schließlich schon eine ganze Generation her. Eingequetscht zwischen äußerer Konkurrenz und innerem Zerfall, erscheint die in den 1990er Jahren des letzten Jahrhunderts vermeintlich siegreiche marktwirtschaftliche, liberale Demokratie heute in einer existenziellen Krise. Woher also Zuversicht schöpfen?
Ich empfehle dazu vier Schritte: Eine kurze Rückbesinnung auf das, was der Westen eigentlich ist; eine realistische Analyse der heutigen Lage; die Frage nach den Ursachen; und schließlich ein paar gute Gründe, auch im 21. Jahrhundert an eine Zukunft des Westens zu glauben.
Was ist eigentlich der Westen?
 Der Westen ist zunächst ein normatives Projekt, sagt der Berliner Historiker Heinrich August Winkler, und damit meint er eine Vorgabe, ein Modell, and dem die Wirklichkeit sich misst, das sie aber nie vollständig erreicht. Der Westen ist sozusagen aufgebaut auf den 3 Hügeln des Abendlandes: Golgatha (Glaube, aber auch Gleichheit der Menschen), Akropolis (Vernunft, aber auch Zweifel), Capitol (Recht und damit Rechtsstaatlichkeit). Daraus folgten historisch der Dualismus zwischen geistlicher und weltlicher Macht, die Entdeckung des Individuums mit unveräußerlichen Rechten, die Gewaltenteilung – also die liberale Demokratie, Fortschrittsglaube und Fortschrittszweifel, bis zur Anti-Wilhelm- und Anti-Hitler-Koalition, zur NATO und zur Europäischen Integration. Dabei hat der Westen immer auch gegen sich selbst gekämpft, angefangen bei Napoleon (also einer Militärdiktatur). Aber er hat nicht nur die Fähigkeit zur Selbstkorrektur, sondern sie ist zu einem konstitutiven Element geworden.
Der Westen ist zunächst ein normatives Projekt, sagt der Berliner Historiker Heinrich August Winkler, und damit meint er eine Vorgabe, ein Modell, and dem die Wirklichkeit sich misst, das sie aber nie vollständig erreicht. Der Westen ist sozusagen aufgebaut auf den 3 Hügeln des Abendlandes: Golgatha (Glaube, aber auch Gleichheit der Menschen), Akropolis (Vernunft, aber auch Zweifel), Capitol (Recht und damit Rechtsstaatlichkeit). Daraus folgten historisch der Dualismus zwischen geistlicher und weltlicher Macht, die Entdeckung des Individuums mit unveräußerlichen Rechten, die Gewaltenteilung – also die liberale Demokratie, Fortschrittsglaube und Fortschrittszweifel, bis zur Anti-Wilhelm- und Anti-Hitler-Koalition, zur NATO und zur Europäischen Integration. Dabei hat der Westen immer auch gegen sich selbst gekämpft, angefangen bei Napoleon (also einer Militärdiktatur). Aber er hat nicht nur die Fähigkeit zur Selbstkorrektur, sondern sie ist zu einem konstitutiven Element geworden.
Wo liegt das Problem?
Die gegenwärtige Krise des Westens lässt sich am besten an drei Jahreszahlen aus den ersten beiden Jahrzehnten des 21. Jahrhunderts fest machen: 2001 mit den 9/11-Anschlägen: das Ende des globalen Vormarsches der liberalen Demokratie; 2008 mit dem Beginn der globalen Finanzkrise: das Ende des ungebremsten globalen Kapitalismus; 2015 mit der Migrationskrise: das Ende der entgrenzten Welt der Globalisierung. In dem Maße, in dem für wachsende Teile der Menschheit Alternativen zum westlichen Wirtschafts- und Gesellschaftsmodell attraktiv wurden, wuchs im Westen selbst die Unsicherheit über das, was der Yale-Historiker Timothy Snyder die “Politik der Unvermeidlichkeit” nannte, also die irreversible Entwicklung der Menschheit hin zur marktwirtschaftlichen Demokratie, dank Globalisierung. Snyder stellt dem die autoritäre “Politik der Ewigkeit” gegenüber, in der nur ständig wechselnde nationale Interessen zählen und Geschichte sich in Zyklen bewegt, und er zeigt, wie sich diese Weltsicht vom Russland der frühen Putin-Ära über den erstarkenden Populismus in Europa bis zum Amerika Donald Trumps ausbreitet. Parallel hierzu haben sich in den letzten dreißig Jahren wirtschaftliche, politische und letztlich auch militärische Macht vom Atlantik zum Pazifik hin verschoben, was nicht nur auf den Aufstieg Chinas zurückgeht, sondern auch den solcher Staaten wie der Türkei, Indiens oder Indonesiens, so dass der klassische geografische Westen an relativem Gewicht verloren hat. Bot China noch vor 20 Jahren Anlass zur Hoffnung, dass das Land sich nach stetiger Öffnung zur Welt zu einer Art von “Demokratie mit chinesischem Antlitz” entwickeln könnte, sind diese Hoffnungen in den letzten Jahren ins Gegenteil umgeschlagen: China wird autoritärer in demselben Maße, in dem es sich zur wirtschaftlichen, technologischen und militärischen Supermacht entwickelt. Immer unverhohlener greift China in die “inneren Angelegenheiten” westlicher Demokratien ein, wenn es seine strategischen Interessen tangiert sieht. Russlands Wandel vom strategischen Partner und zukünftigen Mitglied des Westens zum hybriden Aggressor in 20 Jahren unter Putin ist noch krasser.
Dazu kommt die Bedrohung von innen: Innerhalb des Westens, und auch in der Europäischen Union selbst, hat sich in den letzten zehn Jahren eine Art Gegen-Westen etabliert, der in Ländern wie Polen und Ungarn die Macht erobert hat und so schnell wohl auch nicht wieder abgibt: Identitäre, Populisten und Nationalkonservative, die den Westen eben nicht mehr nach den Prinzipien universeller Menschenrechte und der liberalen Demokratie, sondern nach ethnischen, kulturellen und religiösen Kriterien definieren.
Ein Beispiel: Die amerikanische Journalistin Anne Applebaum hat in ihrer eindrucksvollen Schilderung einer Konferenz über nationalen Konservatismus in Rom Anfang Februar 2020 beschrieben, welches politisch-intellektuelle Hütchenspiel mit dem Erbe von Reagan, Thatcher und Papst Johannes Paul II. gespielt wird. Diese Ikonen einer freiheitlichen Weltordnung werden hier vor den Karren einer Abkehr von NATO und EU gespannt. Wertebasierte Allianzen und supranationale Integration werden hier zu Instrumenten der Ausbeutung der “reinen Völker” durch globalisierte Eliten. Viktor Orbán tut dasselbe mit seiner Umdefinition der Christdemokratie (einer antinationalen, auf Rechtsstaatlichkeit fußenden und den universellen Menschenrechten verpflichteten Bewegung) zu einem illiberalen Projekt zur schrittweisen Abschaffung von Checks and Balances. Äußere Bedrohung und innere Aushöhlung des Westens gehen immer öfter Hand in Hand.
Wie konnte es so weit kommen?
Da ist zunächst die Hybris der Rhetorik vom Ende der Geschichte (Francis Fukuyama) und damit dem endgültigen Triumph des Westens über alle denkbaren Alternativen: Eine Art von Fantasielosigkeit, die den fast unblutigen Sieg im Kalten Krieg auf den Rest der Welt übertrug. Darauf aufbauend kam die Überdehnung liberaler Werte (liberal overreach), von der Intoleranz auf westlichen Campusen bis zum politisch korrekten Einheitsbrei der deutschen öffentlich-rechtlichen Medien. Der Liberalismus selbst wurde in mancher Hinsicht illiberal. Allerdings ist diese Überdehnung an sich berechtigter Prinzipien nicht im Entferntesten vergleichbar mit dem Kollektivismus und dem Propagandacharakter öffentlicher Medien in Polen und Ungarn heute, geschweige denn mit der Wirklichkeitsrelativierung, Fake News und Informationskriegsführung in autoritären Großmächten wie Russland oder China.
Bei aller gefährlichen Vernetzung der Gegenkräfte des Westens sollte aber klar sein: Es gibt keinen nationalistischen Internationalismus. Identitäre und Autoritäre mögen sich auf eine grobe anti-Elitenrhetorik einigen und politische Korrektheit als Meinungsdiktatur geißeln. Nationalisten aus Ländern wie Polen und Ungarn, oder USA und Brasilien, mögen gut miteinander zurechtkommen. Aber Nationalisten aus benachbarten Ländern mit einer schmerzhaften Geschichte wie Polen und Deutschland, Ungarn und Rumänien (und Europa ist voll davon) werden kein positives gemeinsames Programm entwickeln können.
“My country first” ist kein tragfähiges Konzept, um in der Welt Frieden und Wohlstand zu erhalten. Eine Aufteilung der Welt in Großmächte und Einflusssphären haben wir jahrhundertelang ausprobiert – mit den bekannten Folgen. Und, bei Licht betrachtet, beruht das Geschäftsmodell der neuen Autoritären ja gerade darauf, dass es noch eine Anzahl Länder gibt, die nach den klassischen Prinzipien der liberalen Demokratie und des Multilateralismus funktionieren. Wenn z.B. in der EU alle Regierungen agieren würden wie Viktor Orbán, wäre das in wenigen Jahren das Ende der EU. Man stelle sich das Vetoverhalten der ungarischen Regierung in außenpolitischen Fragen im EU-Rat vor, multipliziert mit 26. Oder die in Ungarn inzwischen zum Systemelement gewordenen “nationalen Befragungen” mit der dazugehörigen populistischen Begleitmusik, in den nördlichen Mitgliedsländern angewandt auf die Eurozone oder die Finanztransfers in den Süden.
Was also muss passieren?
Am wichtigsten ist: Nicht den neuen Autoritären nachgeben, egal ob in Peking oder Budapest, das heißt eine robuste Verteidigung und wirksame Abschreckung nach außen, vor allem aber eine stärkere Resilienz gegenüber hybriden Bedrohungen. Auf globaler Ebene muss der “verbleibende Westen” nach neuen Verbündeten suchen und intern Autoritarismus und Nationalkonservatismus effektiver bekämpfen – immer wissend, dass das Ende der Geschichte so schnell nicht eintritt. Letzteres ist eine klassische Aufgabe der Zivilgesellschaft, also Parteien, Bewegungen und Netzwerke von Einzelnen. Bürgerliche Parteien müssen sich weder nach links noch nach rechts entwickeln; sie müssen charismatischere Kandidaten aufstellen und besser kommunizieren. Die EU sollte mehr Fantasie entwickeln bei der Überwachung der Rechtsstaatlichkeit, aber von den in den Verträgen festgelegten Prinzipien keinen Millimeter abweichen.
Die liberale Demokratie muss aber auch immer wachsam bleiben gegenüber den ihr innewohnenden illiberalen Tendenzen und sie bekämpfen. Vor allem aber sollten wir, auch bei einem zweiten Wahlsieg von Donald Trump, nicht denselben Perzeptionsfehler machen wie vor dessen erster Wahl und dem Brexit-Referendum: den gegenwärtigen Trend für das einzig Vorstellbare halten. Es gibt kein Naturgesetz, nach dem ab jetzt nur noch die inneren und äußeren Feinde des Westens auf dem Vormarsch bleiben.
Zwei Gedanken zum Schluss
Manchmal lohnt sich in der gegenwärtigen Krisenstimmung der Blick in die Ferne. Warum riskieren Hunderttausende oft junger Menschen an geografisch vom Westen weit entfernten Orten wie Moskau, Caracas oder Hong Kong ihre persönliche Freiheit, ihre körperliche Unversehrtheit und manchmal auch ihr Leben, für Freiheitsrechte, die angeblich ins 20. Jahrhundert gehören? Der Westen mag zu Hause schwächeln, aber global steckt in ihm noch eine ganze Menge Leben.
Der Westen hat die erstaunliche, und in den Augen seiner Gegner beunruhigende Fähigkeit, immer dann ein Comeback zu erleben, wenn man es am wenigsten erwartet. Schließlich schien der Westen im 20. Jahrhundert schon einmal am Ende angelangt zu sein: als Oswald Spengler den Untergang des Abendlandes voraussagte, als Marktwirtschaft und liberale Demokratie diskreditiert, alt und müde wirkten und autoritäre und totalitäre Bewegungen von links und von rechts so viel frischer und unverbrauchter aussahen. Damals schien die Zukunft nicht den Verfechtern individueller Rechte zu gehören, sondern den Kräften, die das Kollektiv (oder die Nation, oder die Volksgemeinschaft) über allem anderen verorteten: Führern und Bewegungen, die die Instabilität der Parteiendemokratie ablehnten und unabhängige Institutionen als Einschränkung des Volkswillens wahrnahmen – so wie das heute alle Autoritären, von Xi Jinping über Wladimir Putin bis zu Viktor Orbán tun. Wir wissen, wo diese erste Schwächeperiode des Westens endete: im schlimmsten Krieg der Menschheitsgeschichte, der dann in die einzigartige Erfolgsgeschichte der zweiten Hälfte des Jahrhunderts mündete. Und wenn nichts anderes, dann sollte wenigstens das uns Hoffnung machen.