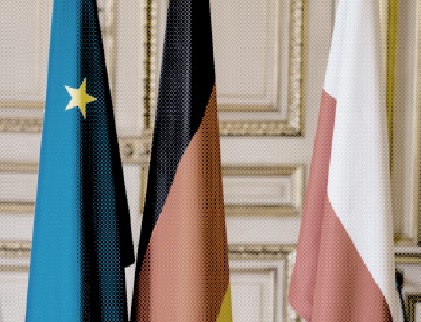Interview mit Prof. Dieter Bingen über Erinnern und Gedenken an die Opfer der deutschen Verbrechen und Besatzung in Polen von 1939 bis 1945. Das Gespräch führte Ricarda Fait.
Ricarda Fait: Herr Professor Bingen, Sie sind einer der Initiatoren der Initiative „Polen-Denkmal“, die vor drei Jahren den Deutschen Bundestag und die deutsche Öffentlichkeit dazu aufrief, den polnischen Opfern der deutschen Besatzung in Polen von 1939 bis 1945 ein Denkmal zu setzen. In Ihrer jüngsten Veröffentlichung „Denk mal an Polen. Eine deutsche Debatte“ haben Sie diese Forderung noch einmal bekräftigt. Am 30. Oktober hat der Deutsche Bundestag nun beschlossen, dass ein eigener Erinnerungsort für die polnischen Opfer des Zweiten Weltkriegs und der nationalsozialistischen Besatzung in Berlin entstehen soll. Wie bewerten Sie diesen Beschluss?
Dieter Bingen: Zu Anfang gestatten Sie eine kleine, aber wichtige Korrektur bzw. Erklärung. Es ging uns in der Initiative um die Errichtung eines Denkmals für die Opfer der deutschen Besatzung in Polen von 1939 bis 1945. Das heißt, den Begriff „polnische Opfer“ haben wir im Laufe der Debatte nicht verwendet, weil er missverständlich ist oder missverständlich wahrgenommen wurde oder verstanden werden wollte. Es geht um das Gedenken an die Opfer der damaligen Zweiten Polnischen Republik unter der deutschen Besatzungspolitik, und das waren sowohl jüdische Polen als auch katholische Polen und polnische Staatsbürger anderer Nationalität und anderer Bekenntnisse.
Polen war 1939 ein multiethnischer Staat, in dem die ethnischen, zumeist katholischen, aber auch protestantischen Polen ungefähr Zweidrittel der Staatsbürger ausmachten. Ein Drittel gehörte anderen Nationalitäten und Bekenntnissen an. Aber sie alle waren Teil der polnischen Gesellschaft und des Staates, der, beginnend mit dem deutschen Überfall auf Polen, vernichtet werden sollte. Die Würdigung der tatsächlichen kulturellen Vielfalt Polens bis 1939 ist uns ein wesentliches Anliegen: eine inklusive Geste, die versinnbildlicht, dass die deutsche Besatzungsherrschaft und der deutsche nationalsozialistische Terror das Ziel hatten, die gesamte Kultur, die gesamte Nation, die polnische Zivilisation und den Staat Polen von der Landkarte zu tilgen. Während der Shoah wurden ungefähr 90 Prozent der polnischen Juden ermordet. Die christlichen Polen sollten, soweit nicht auch sie getötet wurden, später dezimiert zu einem Helotenvolk der Deutschen in einem Großgermanischen Reich werden.
Wer also ist mit der Ansprache „Opfer in Polen“ gemeint?
Damit sind die polnischen Staatsbürger gemeint, die polnisch-jüdischen Opfer, die polnisch-katholischen und polnisch-protestantischen, aber auch polnische Staatsbürgerinnen und Staatsbürger litauischer, ukrainischer, belarussischer oder deutscher Nationalität. Diese Betonung ist in der weiteren Debatte wichtig gewesen, weil es dieses Missverständnis gab, dass sich ein „Polen-Denkmal“ nur an die katholischen Polen richten würde und damit die jüdischen Polen ausschließen bzw. Polen nach unterschiedlichen Nationalitäten oder Glaubensrichtungen aufteilen würde. Das war natürlich nicht unser Ansatz. Denn durch die Brille polnisch-katholischer Nationaldemokraten wird man dem Untergang der polnischen Rzeczpospolita (Republik) im Zweiten Weltkrieg nicht gerecht.
Man kann auch sagen, der Begriff „Polen-Denkmal“ ist missverständlich. Er hat sich nun aber eingebürgert und er lässt sich nicht mehr wegdiskutieren. Ich würde heute eher den Begriff „Denkmal an Polen“ – wie ja auch der Titel meines Buches lautet – wählen im Sinne eines Denkmals, das an Polen gerichtet ist, an die polnische Nation, ihre vormaligen Bürgerinnen und Bürger und ihre heute lebenden Nachfahren.
Das Denkmal ist demnach eine Geste der Würdigung derjenigen, die das millionenfache Morden unter der Zivilbevölkerung nicht überlebt haben. Und es ist eine Geste der Empathie gegenüber den Überlebenden und ihren Nachkommen in der zweiten und dritten Generation. Wie das Holocaust-Denkmal sich an die sechs Millionen ermordeten Juden Europas richtet. Sie sind nicht mehr da, aber es gibt Nachkommen dieser jüdischen Opfer in der ganzen Welt.
Die Geste des Gedenkens und der Erinnerung an das, was von 1939 bis 1945 geschehen ist, richtet sich an die Opfer in Polen. Es ist eine Geste der Würdigung, die ausdrückt, dass die Deutschen von heute verstanden haben, dass es in Polen keine traditionelle Besatzungspolitik gegeben hat mit all den Grausamkeiten, die auch eine sogenannte „normale“ Besatzungspolitik in den letzten Jahrhunderten in und außerhalb von Europa zur Folge hatte, sondern dass es um eine lange vorbereitete und fabrikmäßige Politik der systematischen Tötung von Menschenleben ging. So wie es Hitler kurz vor dem Beginn des Weltkriegs gegenüber seiner Generalität verkündete, dass es um die Vernichtung aller lebendigen Kräfte in Polen ginge. Das Ziel war also die Vernichtung unseres Nachbarn als Staat und Nation.
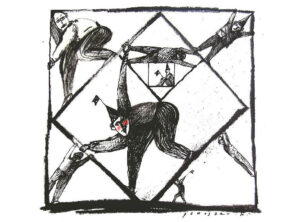
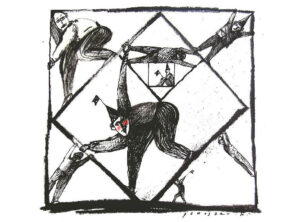
Doch natürlich richtet sich dieses sichtbare Zeichen ebenso an die deutsche Bevölkerung. Es ist ja ein Denkmal, das nach innen wirken soll und nach außen. Nach innen als eine dauerhaft sichtbare Geste, dass wir Deutsche uns in der großen Mehrheit einig sind, dass die preußisch-deutsche Politik gegenüber Polen schon seit dem 18. Jahrhunderts, dann in der Germanisierungspolitik des Kaiserreichs, kulminierend in der qualitativ ganz neuen Vernichtungspolitik in den Jahren 1939 bis 1945, eine exzeptionelle Verantwortung für das Schicksal Polens in Europa hatte und bis heute hat. Ein Denkmal, wenn es denn gebaut wird, wird ja in der Mitte Berlins, der deutschen Hauptstadt, stehen und das heißt, es wirkt natürlich zuerst nach innen in die Berliner und deutsche Gedenklandschaft hinein.
Sie sagen, es sei wichtig, dass die Deutschen zeigen, dass sie verstanden haben. Zeigen es denn die Vertreter der deutschen Gesellschaft mit dem Bundestagsbeschluss vom 30. Oktober? Darin stellt der Bundestag den „singulären“ Fall der nationalsozialistischen Besatzungspolitik in Europa fest.
Als „singulär“ bezeichnet der Bundestag die Umsetzung des Plans der „völligen Vernichtung der Staatlichkeit unseres Nachbarlandes“ im Rahmen der nationalsozialistischen Besatzungspolitik in Europa. Sie hatten zu Beginn danach gefragt, wie ich diesen Bundestagsbeschluss auffasse. Ich muss sagen, ich bin beeindruckt von der Begründung, die dem Beschluss vorausgeht und ich war auch beeindruckt von den Reden im Parlament. Darin wurde auf eine sehr eindringliche Art und Weise und teilweise auch sehr emotional ein Bekenntnis abgelegt, das es in dieser Form und Intensität in den letzten 70 Jahren nicht im Bundestag gegeben hat. Das war eine Sternstunde des deutschen Parlamentarismus, leider von der Öffentlichkeit weitgehend unbemerkt.
Beeindruckend ist auch, dass dieser Beschluss fast einstimmig gefasst worden ist – nicht einmal die AfD hat dagegen gestimmt, sie hat sich enthalten. Ansonsten aber wurde der Beschluss von allen Fraktionen – auch von der Fraktion der Linken, obwohl sie ja einen eigenen Antrag eingebracht hatte – getragen.
Bei alledem bleibt jedoch ein Wermutstropfen, und zwar dass sich der Deutsche Bundestag nicht ausdrücklich für ein Polen-Denkmal im Rahmen eines Polen gewidmeten Orts des Gedenkens, der Bildung und Begegnung ausgesprochen hat, sondern eher vage in seinen Formulierungen blieb. Der Wortlaut im Beschluss zeugt ansonsten von einer Unentschiedenheit – oder positiv formuliert: einer Offenheit – und überlässt weiteres der kommenden Konzeptualisierung. Das mag auch von politischer Rücksichtnahme auf die Gegner eines Denkmals zeugen, die es weiterhin gibt – auch innerhalb der Parteien, die diesem gesonderten Ort für Polen zugestimmt haben. Der 30. Oktober war eine wichtige Etappe, aber jetzt beginnt das Ringen um die Konzeption.
Das Denkmal ist zwar nicht explizit erwähnt, aber bisher auch nicht ausgeschlossen. Anfang des neuen Jahres soll die Regierung einen Entwurf für das Konzept vorlegen und ausarbeiten, was unter diesem Erinnerungsort zu verstehen sein sollte. Was spricht denn für Sie explizit für das Denkmal, was andere Erinnerungsformen wie ein Museum nicht leisten könnten?
Für das Denkmal spricht ganz klar und einfach, was vielen immer noch schwerfällt: die symbolische deutsche Geste der Empathie, ein Zeichen der Würdigung der Millionen Opfer und Verluste, das sind die Menschen, das sind aber auch die gebrandschatzten oder von deutschen Kunstexperten und Museumsleuten geraubten Zeugnisse der Kultur, die nahezu vollständige Zerstörung des alten Warschaus mit Brand- und Sprengkommandos im Herbst 1944 nach dem Warschauer Aufstand.
Ein Denkmal wäre ein herausgehobenes, sichtbares Zeichen, ein in die Höhe ragender Stolperstein. Das kann und soll ein Museum nicht leisten. Ein Museum, eine Dokumentation soll bilden und die Zusammenhänge erklären, ein in seinem Ausdruck gelungenes Denkmal kann nur staunen machen, aufrütteln. Die Initiatoren und Unterstützerinnen und Unterstützer der Denkmal-Initiative weisen seit drei Jahren darauf hin, und auch in der Diskussion ist es immer wieder von Publizisten, Historikern, teilweise von Politikern hervorgehoben worden, dass ein Denkmal eine besondere Geste der Empathie, etwas Herausgehobenes und eine Verdichtung ist. Es geht dabei um ein besonderes Zeichen, das aufrüttelt und zum Nachdenken anregt.
Wobei ein Museum doch mehr zum Austausch und zur Bildung beiträgt, die, wie wir ja in der Debatte festgestellt haben, im Großteil der Gesellschaft fehlt. Immer wieder wurden eine Leerstelle und „blinde Flecken“ in der Erinnerung betont.
Deswegen sagen wir auch, es soll ein Denkmal geben, das nach Ergänzung ruft. Das Mahnmal soll wie ein Stein des Anstoßes wirken. In einem zweiten Schritt wird es darum gehen, auf die Fragen, die durch das Denkmal aufgeworfen werden, Antworten zu geben.
Dazu gehören Information und Bildung, das fordert schließlich auch der Bundestagsbeschluss. Neben der emotionalen Leerstelle gibt es auch eine Leerstelle des Wissens. Dafür bedarf es eines Raumes der Auseinandersetzung mit der Geschichte und der zivilgesellschaftlichen Aktivitäten wie Jugendarbeit, politische Bildung, Begegnung. All dies vermag aber nicht das symbolische Zeichen der Empathie und der Würdigung eines Adressaten ersetzen. Das Eine und das Andere gehören zusammen: die „einseitige“ Geste und der beidseitige Austausch.
Ich verstehe, dass die Deutschen einerseits mit Denkmälern und Symbolen ein Problem haben, denn es mussten genügend schreckliche Denkmäler gestürzt werden. Außerdem hört man immer wieder, das Denkmal sei anachronistisch, statt Denkmälern bräuchten wir Aufklärung. Andererseits werden nicht nur in Berlin laufend neue Denkmäler und Mahnmale errichtet – und kaum jemand stört sich daran. Wir sind überzeugt: Mahnmale als Steine des Anstoßes und als Aufforderung zur Aufklärung sind nach wie vor aktuell.
Vor zwanzig Jahren ist das Denkmal für die ermordeten Juden Europas errichtet worden und richtigerweise hat man danach festgestellt, dass dieses riesige Stelenfeld zu wenig ist. Deshalb ist später zur Vervollständigung der anfangs abgelehnte, aber unbedingt wichtige Ort der Information in das Ensemble integriert worden.
Diejenigen, die ein Polen-Denkmal ablehnen, begründen das oft damit, dass man sich als Europäer definieren und sich deshalb gegen die Nationalisierung stellen sollte. Ich möchte dagegenhalten: Nicht „die Europäer“ sind drangsaliert, verfolgt, ermordet worden, sondern es waren Nationen, Kulturen, Polen und der polnische Staat. Deswegen ist es richtig, dass ein Denkmal individuell adressiert wird, so wie das Land damals auch als Opfer adressiert wurde. Es ging um Polen. Und es war eine Besatzungspolitik gegenüber unserem Nachbarn, mit dem wir seit tausenden Jahren nebeneinander und zusammenleben. Dafür ist ein Bekenntnis notwendig und nicht die Flucht vor der Geste der Empathie.
Ein Denkmal kann natürlich an schlechten Entwürfen scheitern. Aber die Diskussion über den am ehesten geeigneten, der Würdigung angemessenen Entwurf ist dann möglich, wenn über die eingegangenen Projekte zu entscheiden ist. Dabei geht es auch um die Gestaltung des Ortes für Dokumentation, Bildung, Austausch und Begegnung.
Am 9. Oktober wurde auch ein weiterer erinnerungspolitischer Entschluss vom Deutschen Bundestag über die Errichtung eines Dokumentationszentrums für die nationalsozialistische Besatzungsherrschaft in Europa gefasst…
Genau, diesen Beschluss zu einer Dokumentations-, Bildungs- und Erinnerungsstätte zur Geschichte des Zweiten Weltkriegs und der nationalsozialistischen Besatzungsherrschaft würde es ohne unsere Denkmalinitiative nicht gegeben haben. Dieser Vorschlag ist ja quasi aus dem Hut hervorgezaubert worden, um einen Ersatz für das Polen-Denkmal zu schaffen und dieses Projekt zu verhindern. Dem vorausgegangen war seit 2013 die Initiative zum Gedenken an die Opfer der „Lebensraumpolitik“ im Osten. Und nun ist ein Dokumentationszentrum herausgekommen, das ja eigentlich eine moderne Dokumentation, eine Art modernes Museum des Zweiten Weltkriegs werden soll. Darin soll die deutsche Besatzungspolitik in ihrer Unterschiedlichkeit in den verschiedenen Regionen, Staaten und Nationen Europas von Norwegen bis nach Griechenland, von Frankreich bis Russland dargestellt werden. Es ist vorhersehbar, dass es ein konzeptionell sehr schwieriges Projekt werden wird, weil ja alles im Austausch und möglichst im Einvernehmen mit Vertreterinnen und Vertretern von weit mehr als zwanzig betroffenen Ländern dargestellt werden soll.
Dafür, wie richtungsweisend diese beiden Beschlüsse waren, schien mir das Medienecho vergleichsweise gering. Im Vorfeld, besonders während des Sommers, nachdem das DPI und die Stiftung Denkmal einen gemeinsamen Konsens- bzw. Kompromissvorschlag vorgestellt hatten, aber auch bereits davor, wurde die Debatte zwischen Anhängern und Gegnern eines eigenen Gedenkens an Polen bzw. eines gemeinsamen Gedenkens sehr scharf geführt. Wie ordnen Sie die medialen Kommentare oder das mediale Schweigen ein? Zeigt es, dass die konkurrierenden Lager befriedet sind?
Um Ihre letzte Frage zuerst zu beantworten: Die beiden Beschlüsse konkurrieren nicht miteinander, vielmehr ergänzen einander die Leitideen und Konzeptionen beider Gedenkkomplexe.
Wenn man das Medienecho nach den Beschlüssen vom 9. und 30. Oktober vergleicht, war nach meiner Wahrnehmung das Echo zum Gedenken an Polen größer, wurde sowohl vor wie nach dem Beschluss mehr und engagierter kommentiert als zu dem Beschluss für das allgemeine Weltkriegsdokumentationszentrum. Das ist für mich auch ein Hinweis darauf, dass die Ansprache und das Aufrütteln durch die Adressierung eines individuellen Adressaten oder einer Opfernation und die Individualisierung des Gedenkens mehr Aufmerksamkeit erregt und anspricht als das Allgemeine, die Ansprache an ein großes Kollektiv – die Opfer der deutschen Besatzungsherrschaft in Europa.
Es hat mich sehr verwundert und enttäuscht, dass kaum gewürdigt wurde, dass hier eigentlich das Startzeichen für ein modernes Zweite-Weltkriegs-Museum aus der Perspektive der Nachkommen der Täter gesetzt wurde. Das ist doch ein großes bahnbrechendes Projekt, vergleichbar nur mit dem Museum des Zweiten Weltkriegs in Danzig – um es etwas salopp zugespitzt zu sagen: Und keiner schaut hin.
Da gilt meine Kritik auch den deutschen Medien, nicht zuletzt den Öffentlich-Rechtlichen, die einen besonderen Bildungsauftrag haben. Sie haben weder davor noch danach in einer dem Anlass angemessenen Weise vor allem über den Beschluss vom 9. Oktober berichtet. Vermutlich ist das auch der Fokussierung der Öffentlichkeit und der Medien auf die Corona-Krise und die US-Wahlen geschuldet. Unabhängig davon halte ich es aber für bedauerlich, denn solch ein Projekt geht die gesamte deutsche Öffentlichkeit etwas an. Und was den Beschluss vom 30. Oktober betrifft, gab es vielleicht etwas mehr Berichterstattung, aber die war teilweise auch unpräzise, missverständlich, was auch wieder ärgerlich ist.
Haben Sie ein Beispiel dafür?
Die Frankfurter Allgemeine Zeitung, die generell in den vergangenen Jahren das Thema immer wieder sehr informativ und diskursiv aufgegriffen hat, begnügte sich am 30. Oktober mit einer epd-Quelle und behauptete, dass es ursprünglich um ein „Denkmal für die polnischen Opfer des Holocaust“ gegangen sei. Und jetzt sei ein Polen-Denkmal ausgeschlossen worden. Beides entspricht ja nicht der Faktenlage. Allerdings bin ich im Endeffekt nicht so unzufrieden mit dem Medienecho zum Bundestagsbeschluss vom 30. Oktober hinsichtlich seiner Quantität, eher mit der Qualität. In Deutschland hat man teilweise von einem definitiven Beschluss zugunsten eines Polen-Denkmals – oder eben dagegen – geschrieben. In Polen schrieben die Zeitungen und sprachen die Politiker vor allem von einem beschlossenen Polen-Denkmal. Man sieht, dieser Begriff hat seine eigene Dynamik.
Die Berichterstattung steht auch wiederum nicht so schlecht da, weil das Thema Polen immer zu Aufregung führt. Keine andere bilaterale Beziehung in Europa ist so mit negativen und positiven Emotionen besetzt und hat ein solches Erregungspotenzial wie das deutsch-polnische Verhältnis. Deshalb scheint es auch relativ leicht, in die Schlagzeilen zu kommen und gleichzeitig macht es das schwer, eindeutig positive Signale in die deutsche Öffentlichkeit zu senden. Eine so emotionale Ablehnung wie die eines Polen-Denkmals als höchste Form von Nationalismus kann ich mir kaum bei einer Diskussion über ein Denkmal für andere nationale Opfergruppen vorstellen.
Dies ist ja auch eine These in Ihrem Essay, Sie schreiben, der Widerstand gegen das Denkmal würde umso größer, je deutlicher auf die Leerstelle in der deutschen Erinnerung hingewiesen würde.
Ja so ist es, das ist die Geschichte der letzten drei Jahre.
Dass es bei diesem Polen-Denkmal solch einen Widerstand gab, ist nur nachvollziehbar aufgrund der traditionellen deutschen Sicht auf Polen und der deutschen Stereotype, die bis heute teilweise vorhanden sind. Die hängen auch mit der Geschichte einer „Abrechnung“ zusammen, getreu dem Motto, was wollen die Polen denn noch? Die Polen haben uns über 20 Prozent des Territoriums genommen und 9 Millionen Menschen wurden aus den ehemals deutschen Ostprovinzen vertrieben oder sind geflohen. Damit wären wir quitt. Warum sollten wir den Polen jetzt noch ein Denkmal setzen?
Dabei wurde in Polen der deutsche Zivilisationsbruch vorexerziert. Da kann man nicht einfach sagen, für die Polen wollen wir kein Gedenken. Man kann die Erinnerung daran auch nicht einfach in einem europäischen Gedenken wie einem Dokumentationszentrum aufgehen lassen. An der Genese der Idee eines Dokumentationszentrums für die deutsche Besatzungspolitik im Zweiten Weltkrieg sieht man, welcher Aufwand getrieben wurde, um ein gesondertes Polen-Gedenken zu verhindern. Und nun werden wir zwei Gedenkorte haben – für „Alle“ und für Polen.
Lassen Sie uns den Blick doch noch auf die Wirkung einer solchen Geste richten. Ein Satz in Ihrem Essay lautet „Wir brauchen Heilung durch eine Geste“. Um wessen Heilung ging es Ihnen dabei?
Es geht um die Heilung bei uns Deutschen. Wir sollten uns selbst heilen, indem wir diese Lücke füllen, und zwar intellektuell in der wissenschaftlichen Auseinandersetzung und in der Bildung – dafür ist Dokumentation notwendig. Und es geht um eine emotionale, würdigende Geste der Empathie. Das ist mehr als Wissen, und es ist etwas, was wachsen muss.
Die Diskussion über ein Denkmal erfolgt in einer fortgeschrittenen Phase eines Prozesses der historischen, politischen, gesellschaftlichen Auseinandersetzung im deutsch-polnischen Verhältnis, aber auch der Deutschen untereinander über ihre eigene Gewaltgeschichte in Europa. Das kommt nicht von heute auf morgen. Und die Sensibilisierung kommt auch nicht deshalb, weil ein Botschafter interveniert, eine ausländische Regierung Druck macht oder weil ein großer polnischer Patriot und Freund Deutschlands es fordert. Wenn die deutsche Gesellschaft sich nicht mit sich selbst auseinandersetzt, dann passiert es nicht.
Dieser Bundestagsbeschluss setzt so auch einen vorläufigen Endpunkt eines innerdeutschen und deutsch-polnischen Diskurses. Das heißt, das Anliegen der Errichtung eines Ortes der Erinnerung und Begegnung, in dem auch ein Denkmal Platz hat, wird anerkannt. Und ich möchte sagen, es gibt auch Platz für die individuelle Würdigung anderer Nationen, die Opfer wurden.
Wenn es beispielsweise im deutsch-ukrainischen Verhältnis und in der Ukraine selbst eine Auseinandersetzung mit der Geschichte gegeben hat, dann lässt sich auch über einen Ukraine-Gedenkort nachdenken, wenn das ein Bedürfnis ist und auch die Ukrainer selbst das für eine geeignete Geste in Berlin halten. Es ist ja möglich, dass andere Nationen gar nicht danach streben. Aber das muss in den Gesellschaften und zwischen der deutschen und den jeweils anderen Gesellschaften wie der ukrainischen, russischen, belarussischen, griechischen entstehen, dann lassen sich auch spezifische Formen der Erinnerung mit den anderen Gesellschaften denken. Ich habe keine Angst vor einer Denkmal-Inflation. Doch es sind sehr komplexe Austragungsprozesse, die in Deutschland zu solchen Initiativen wie der unsrigen führen.
Wie könnte es denn weitergehen, nach dem Errichten eines Erinnerungsortes? Manuel Sarrazin (Grüne), Vorsitzender der Deutsch-Polnischen Parlamentariergruppe, hat in der Aussprache des Bundestages einen bemerkenswerten Satz gesagt, in dem er die Bedeutung für diesen Bundestagsentschluss noch einmal zuspitzte: „Europa wird scheitern, wenn die deutsch-polnische Freundschaft nicht gelingt“. Was braucht es denn in der Zukunft, um die Freundschaft zwischen Deutschland und Polen weiter lebendig zu halten und weiter wachsen zu lassen – auch angesichts der politischen Entwicklungen in der EU?
Grundlegend ist die gegenseitige Erkenntnis, dass sowohl die Entwicklung in Deutschland wie auch die Entwicklung Polens und die Zukunft beider Staaten in Europa entscheidend davon abhängt, wie sie ihre bilateralen Verhältnisse und ihren Nachbarn im europäischen Setting wahrnehmen. Wichtig ist, ob sie sich als strategische Partner sehen, die sich grundsätzlich aufeinander verlassen können, auch bei Dissens in Einzelfragen und Interessenkonflikten, die es immer geben wird, und dass sie sich gegenseitig zuhören.
Eine wirkliche Partnerschaft muss zu einer Selbstverständlichkeit werden. Das klingt immer wie eine Floskel, aber sie muss in Fleisch und Blut übergehen. Das gilt natürlich für beide Seiten. Das heißt, Voraussetzung dafür, dass es besser und gut wird, sind offene und liberale Gesellschaften und weitere Verflechtung, auch gegenseitige Neugier bei den aktuellen politischen Herausforderungen, die teilweise globale oder europäische Fragen berühren. Wir müssen weiter nach Gemeinsamkeiten suchen und danach, wie diese auch im europäischen Kontext eingebracht werden können oder wie wir bei Auseinandersetzungen zumindest konstruktive Lösungen finden können. Nur offene liberale Gesellschaften können auf Dauer eine gute Nachbarschaft und Partnerschaft aufbauen. Und wir brauchen immer die Bereitschaft zum Perspektivwechsel.


Prof. Dr. Dieter Bingen ist deutscher Politikwissenschaftler und Zeithistoriker, war bis September 2019 zwanzig Jahr lang Direktor des Deutschen Polen-Instituts in Darmstadt. Er ist Träger zahlreicher Auszeichnungen, Honorarprofessor an der Hochschule Zittau/Görlitz, war Gastprofessor an der Technischen Universität Darmstadt. Zuletzt erschienen sind von ihm „Denk mal an Polen. Eine deutsche Debatte“ (Berlin: edition.fotoTAPETA 2020) und als Herausgeber (mit Simon Lengemann) „Deutsche Besatzungspolitik in Polen 1939 – 1945. Eine Leerstelle deutscher Erinnerung?“ (Bonn: Bundeszentrale für politische Bildung 2019). Bingen lebt und arbeitet in Köln.


Ricarda Fait ist Slawistin, Musikwissenschaftlerin und Redakteurin bei DIALOG FORUM.


Eine deutsche Debatte
Dieter Bingen
Berlin: edition FotoTAPETA 2020
82 Seiten
Preis: 9.50 €
ISBN: 978-3-940524-98-0