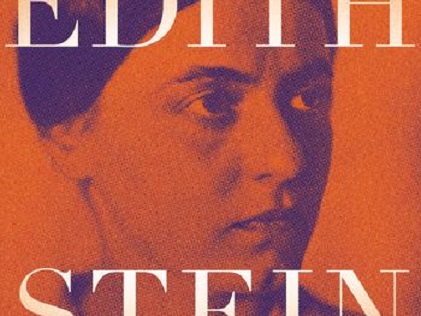Anlässlich des Todes des berühmten polnischen Lyrikers Adam Zagajewski (21.06.1945-21.03.2021) erinnern wir an sein Gespräch für das Deutsch-Polnische Magazin DIALOG über Berlin, die deutsche Sprache und die Bedeutung der Dichtung
Dorota Danielewicz: Berlin ist ein wichtiges Kapitel in Ihrem Leben. Im Jahre 1979 kamen Sie im Rahmen eines Stipendiums des Künstlerprogramms vom Deutschen Akademischen Austauschdienst (DAAD) in den Westteil der Stadt. Zwei Jahre lebten Sie in Berlin und konnten von hier aus die Anfänge der Solidarność-Revolution beobachten sowie die Stadt kennen lernen, in die Sie seit 30 Jahren regelmäßig wiederkommen …
Adam Zagajewski: In Berlin war ich der Meinung, ich sei ein wohlhabender Mensch geworden, denn als Stipendiat des DAAD konnte ich mir einen alten VW-Käfer kaufen. In Polen war es damals angesagt, den Käfer zu fahren. Mit ihm fuhr ich dann anderthalb Jahre durch Berlin und lernte die Stadt dabei gut kennen.
Wie sehen Sie die Veränderungen, die in den letzten Jahren in Berlin stattgefunden haben?
Ich kann nicht behaupten, mir würde das jetzige Berlin weniger gefallen als das, in dem ich vor dreißig Jahren gelebt habe – möglicherweise gefällt es mir sogar mehr, es ist lebendiger und facettenreicher. West-Berlin erinnerte vor dem Mauerfall an eine Torte, die wenige Schichten hatte. Aus der Perspektive eines Ankömmlings aus dem kommunistischen Polen war es eine wohlhabende Stadt, in der ich keine Armut sah. Es gab natürlich Kreuzberg, aber das war eher „alternativ arm“, und nicht eine wirkliche Armut. Das heutige Berlin ist eine echte Stadt, in der alles zu finden ist: sowohl heruntergekommene, als auch reichere Gegenden – ich habe das Berlin von heute lieber. Es kommt einem immer vor, als wären die Erinnerungen schöner, aber ich versuche, mich dieser Illusion nicht hinzugeben.
Sind Ihnen Ihre Freundschaften aus der Zeit Ihres ersten längeren Aufenthaltes in Berlin erhalten geblieben?
Eigentlich nicht. Ich bedaure es, aber irgendwie hat sich das alles in Luft aufgelöst. Ich erinnere mich gerne an die Treffen im Hause von Helena und Wiktor Szacki, polnischer Emigranten, die in West-Berlin lebten. Ihr Haus war in den 1970er und 1980er Jahren Mittelpunkt des gesellschaftlichen Lebens der künstlerischen Intelligenz aus Polen. Jeder Stipendiat wurde zwangsläufig bei der Familie Szacki eingeladen, die in der wunderschönen Villengegend Grunewald lebte. Auch Zbigniew Herbert oder Witold Wirpsza, ein im Exil in West-Berlin lebender Dichter waren ihre Gäste. Hin und wieder kam auch Kazimierz Brandys zu Besuch, der damals Stipendiat in Berlin war, sowie Wiktor Woroszylski. Zu jener Zeit gab es eine Art polnisches Berlin der Schriftsteller und Künstler, aber das gehört längst der Vergangenheit an, viele dieser Menschen sind tot. Auch der Schriftsteller Jürgen Fuchs lebt leider nicht mehr, ein politischer DDR-Flüchtling, dessen Tod ein Rätsel blieb: Man wusste nicht, ob er tatsächlich von der Stasi ermordet wurde. In den zwei Jahren, die ich in Berlin verbrachte, sahen wir uns häufig.
Später traten in mein Leben andere Berliner Freundschaften ein, wie zum Beispiel die mit Sebastian Kleinschmidt, dem Chefredakteur der Zeitschrift „Sinn und Form“, einem einnehmenden Menschen. Ihn konnte ich früher, Anfang der 1980er Jahre gar nicht kennenlernen, weil er im Ostteil der Stadt lebte. Genauso unmöglich war es für mich, die Bekanntschaft des herausragenden Übersetzers Henryk Bereska zu machen, mit dem ich mich erst nach dem Mauerfall anfreundete. Die Freundschaft mit Sebastian Kleinschmidt wurde für mich sehr wichtig – auch aufgrund ihres intellektuellen Charakters. Ich bewundere ihn sehr, er ist ein enorm intelligenter Mensch, der nach dem Zusammenbruch der DDR die ostdeutsche literarische Zweimonatszeitschrift „Sinn und Form“ zu einer der interessantesten und inspirierendsten Intellektuellenzeitschriften in Deutschland gemacht hat. Berlin ist für mich nach wie vor eine lebendige Stadt, aber es gibt eben wenig Kontinuität, wenn es um die früheren Freundschaften geht.
Haben Sie Ihre Lieblingsorte in Berlin?
Ich bin sehr sentimental, daher habe ich sehr viele Lieblingsorte. Besonders mag ich das Berlin der Flüsse und Kanäle, für mich ist das die interessanteste Seite der Stadt – eine Art Venedig ohne die Leichtigkeit und ohne den Zauber Venedigs; ein schweres, aber sehr grünes Venedig. Während meines zweijährigen Aufenthaltes in Berlin lebte ich übrigens nie an der Spree oder an der Havel, umso mehr mochte ich diese Ecken und die Spaziergänge entlang der Flüsse, Kanäle und Seen. Früher mochte ich die Gemäldegalerie in Dahlem, die dann ins Zentrum der Stadt umgezogen ist und heute weiterhin ein wunderbarer Ort bleibt. In Dahlem hatte sie damals noch eine provinzielle Färbung, denn das Museum lag abseits. Meine erste Wohnung in Berlin war in der Nähe vom Schlachtensee, im Südwesten der Stadt. Als ich mich für sie entschied, wusste ich nichts über Berlin. Später bereute ich die Entscheidung, denn die Gegend war weit vom Stadtzentrum entfernt, ein langweiliger, spießiger Stadtteil – nur, dass man da im See baden konnte, was einer der wenigen Vorteile war. Ich habe keine Schwäche für Villengegenden im Süden Berlins, heute fasziniert mich eher das Zentrum.
Sie sprechen ein sehr gutes Deutsch. Wie stehen Sie zur deutschen Sprache?
Leider komme ich selten dazu, Deutsch zu sprechen – ich müsste wieder ein paar Wochen in Deutschland verbringen, um die Sprache aufzufrischen, weil ich doch einige Wörter vergessen habe. Ich fühle mich inzwischen im Englischen sicherer, ich unterrichte an der Universität Chicago und habe in den letzten Jahren sogar einige Essays auf Englisch geschrieben.
Deutsch war meine erste Sprache – meine absolut erste Sprache. Als wir nach dem Krieg in Gleiwitz gelebt haben, hatten wir ein deutsches Kindermädchen, eine reizende junge Frau, die zur Freundin der Familie wurde. Meine Eltern sagten mir immer, meine ersten Worte, die ich ausgesprochen habe, waren auf Deutsch, weil ich mit dem Kindermädchen so viel Zeit verbrachte. Für mich ist die deutsche Sprache ein Teil meiner Familientradition. Mein aus Lemberg stammender Großvater war absolut zweisprachig: deutsch-polnisch. Mein Kinderdeutsch habe ich vollkommen vergessen, aber später kümmerte sich eben mein Großvater darum, dass ich Privatunterricht in Deutsch bekam. Nach meiner Ankunft in Berlin wurden die uralten Schichten der deutschen Sprache, die sich in meinem Gedächtnis befanden, aktiviert, und nach ein paar Monaten sprach ich wieder ein sehr gutes Deutsch.
Ich habe – so wie viele Polen – ein ambivalentes Verhältnis zur deutschen Zivilisation. Auch wenn ich selbst erst nach dem Krieg geboren worden bin, habe ich in den tiefsten Winkeln meines Gedächtnisses das Trauma dieses Krieges behalten. Auf der anderen Seite trage ich in mir die absolute Faszination für deutsche Literatur und Musik. Diese Faszination für das Deutschtum habe ich zum großen Teil dem Gleiwitz der Nachkriegszeit zu verdanken, der Stadt, in der ich aufgewachsen bin, sowie meinem Großvater. Ich weiß von meinem Vater, dass mein Großvater in seinen letzten Stunden angefangen hat, auf Deutsch zu sprechen, als kehre er wieder zu seiner ersten Sprache zurück, denn das war Deutsch für ihn. Auch in dem familiär-existenziellen Kontext steht mir Deutsch näher als alle anderen Fremdsprachen – bei dem Englischen oder Französischen fehlt mir der familiäre Zusammenhang.
Außer der deutschen und englischen Sprache sprechen Sie auch sehr gut Französisch – Sie haben 20 Jahre in Paris gelebt. Welche dieser Sprachen eignet sich am besten, um Gedichte zu schreiben?
In jeder dieser Sprachen wurde große Dichtung geschaffen, aber ich kann nur auf Polnisch schreiben. Ich spreche und schreibe auf Englisch, doch ausschließlich Essays. Ich kann mir nicht vorstellen, ein Gedicht in einer anderen Sprache als die polnische zu verfassen. Auch auf Deutsch habe ich einige Texte geschrieben, aber es waren kurze Skizzen.
Der letzte Band mit Ihren Skizzen, der in Polen herausgegeben wurde, trägt den Titel „Poeta rozmawia z filozofem“ (Der Dichter spricht mit dem Philosophen). Ich habe den Eindruck, dass dieser Titel Ihr Schaffen treffend beschreibt …
Ich spüre in mir den Streit eines Philosophen mit einem Dichter. Selbstverständlich ist mir die Dichtung wichtiger, weil sie ein lebendiger und dramatischer Angriff auf die Welt ist. Meine Skizzen entstehen dagegen an ruhigeren, mehr nachdenklichen Tagen. Außerdem arbeitet in jedem Essayisten ein Dichter. Ich halte mich für einen Schüler der polnischen Essay-Schule, nicht nur der polnischen Dichterschule. Ich schätze Stempowski, Brzozowski, Miciński, Kijowski, Miłosz und Herbert sehr als Essayisten, auch Zygmunt Kubiak und andere Autoren. Sie gehören zu dem großen Reichtum unserer Literatur.
Wie würden Sie heute die Bedeutung sowie die Stellung der Dichtung einschätzen? Joseph Brodsky war der Meinung, Dichtung setze Maßstäbe …
Dieser Meinung bin ich nicht. Bei allem Respekt für Brodsky – ich bin ein größerer Realist. Die Stellung der Dichtung in der Welt gestaltet sich viel bescheidener. Dichtung ist gleichzeitig ein Sprung in etwas anderes, in ein Geheimnis, und dieser Sprung erlaubt ihr manchmal, die Realität zu erhellen. Es fasziniert mich, dass wir in der Dichtung – aber auch in anderen Künsten – mit einer Energie zu tun haben, die der spirituellen Energie ähnlich ist. Das ist eine riskante These, die theologisch schwer zu verteidigen ist, obwohl zum Beispiel Hans Urs von Balthasar die Existenz Gottes durch Schönheit beweist. Für mich ist Dichtung eine Suche nach dieser besonderen Energie.
Kommen wir noch einmal auf Ihre Berliner Erfahrungen zurück. Was bedeutete Ihnen dieser zweijährige (von 1979 bis 1981) Aufenthalt in West-Berlin?
Nachdem ich im September 1981, kurz vor der Einführung des Kriegsrechtes, nach Polen zurückgekehrt war, verbrachte ich noch über ein Jahr in Krakau. Im Dezember 1982 ging ich nach Paris, wo ich zwanzig Jahre lang lebte. Berlin war für mich der Anfang einer biografischen Diskrepanz. Ich verpasste auch einige große Ereignisse, wie den August 1980, die Zeit der großen Streiks in Polen. Die Entstehung der Solidarność erlebte ich in Berlin. Auch während des ersten Papstbesuches in Polen 1979 war ich in West-Berlin. Ich bedaure diese Entfernung etwas, auf der anderen Seite denke ich jedoch, dass es mir dank Berlin gelungen ist, eine innere biografische Festung zu errichten, um unabhängig von den großen polnischen Massenereignissen leben zu können, um in meinem Inneren nur mein eigenes Leben zu leben – natürlich verfolgte ich dabei das, was in Polen geschah, und nahm indirekt daran teil.
Ich habe im Radio Menschen reden gehört, die, nach dem wichtigsten Augenblick ihres Lebens gefragt, geantwortet haben: „Ich war in der Danziger Werft im August 1980.“ Eine solche Verschmelzung der Menschen mit der Biografie der Nation irritiert mich ein wenig. In Polen gibt es eine gewisse Tendenz zur Stilisierung, damit die Biografien der Einzelnen an die Biografie der Nation „angeklebt“ werden können. So werden der Papstbesuch, der August 1980 sowie die ersten freien Wahlen in Polen im Jahre 1989 häufig als die bedeutendsten Momente im Leben genannt. Ich habe nichts dagegen, denn ich glaube, es waren tatsächlich außerordentliche Ereignisse, nur habe ich den Eindruck, dass Polen sehr leicht ihre individuellen Biografien aufgeben und sie sehr krampfhaft an die großen nationalen Ereignisse dranhängen wollen. Ich sehe darin nichts Schlimmes, aber es ist vielleicht besser, über gewisse biografische Reserven zu verfügen.
Berlin hat mir dabei geholfen, eine Art Gleichgewicht zwischen einer individuellen und einer kollektiven Erfahrung zu erreichen – auch wenn ich als ein großer Anhänger der antikommunistischen, noch vor Solidarność existierenden Opposition, nach West-Berlin gekommen bin. Ich kann mich sehr gut daran erinnern, wie sehr mir das Fieber des oppositionellen Lebensstils in den ersten Wochen und Monaten in Berlin gefehlt hat. Ich habe das intensive Leben der Opposition nicht deswegen hinter mir gelassen, weil ich mich in ihm nicht wohlgefühlt hätte. Ich begann jedoch zu verstehen, dass es gut wäre, ein zurückgezogenes Leben auszuprobieren, ohne dabei das politische Engagement abzulehnen. Berlin wurde zu einem wichtigen Ort für meine Weiterentwicklung, ich war damals noch jung und ungeformt. Und es war eben Berlin, das mir dabei half, die Form für meine Zurückgezogenheit herauszufinden und auch dabei, von der tosenden patriotischen Kampagne getrennt, die in Polen vor sich ging, nicht zu verkümmern.
Trotzdem unterhielten Sie, als Sie in West-Berlin lebten, Kontakte zu der antikommunistischen Opposition in Polen, Sie halfen der Untergrundbewegung …
Ich habe ein paar Mal Zubehör für Vervielfältigungsgeräte aus West- nach Ost-Berlin geschmuggelt, die ich dann in der Hauptstadt der DDR an Jacek Pałasiński von KOR (Komitee zur Verteidigung der Arbeiter) weitergegeben habe. Das war noch vor der Solidarność-Zeit, das KOR brauchte verschiedene Sachen, die in Polen nicht zu bekommen waren. In die DDR kam ich durch den Grenzübergang Friedrichstraße. Ich hatte ein bisschen Angst, aber zum Glück wurde ich nie erwischt. In der Regel waren es nicht viele Dinge, aber 1980 kam eine große Bestellung aus Warschau – es ging um eine ganze Druckmaschine. Sie war viel zu groß, als dass ich sie alleine schmuggeln könnte. Es hat sich aber so ergeben, dass ich zu diesem Zeitpunkt einer Gruppe junger Deutscher, die in einer Wohngemeinschaft lebten, Polnischunterricht gab. Und sie hatten vor, in Urlaub nach Polen, nach Masuren zu fahren. Ich fragte sie, ob sie nicht eine Druckmaschine schmuggeln würden. Sie konnten es kaum erwarten, ihnen gefiel solch ein großes Abenteuer. Alles wurde geklärt und so fuhren sie mit einem grünen VW-Bus los. In Polen wurden Kontakte bezüglich der Übergabe vereinbart. Sie schafften die Maschine problemlos über die Grenze, aber sie weckten das Interesse der Miliz. Die Übergabe gestaltete sich deswegen sehr kompliziert, schließlich hat es aber geklappt. Nachdem die deutschen Touristen nach Masuren weitergefahren waren, stellten die Leute vom KOR, die die Druckmaschine abgeholt hatten, fest, dass der wichtigste Teil in dem VW-Bus geblieben ist. Eine dramatische Suche begann. Von dem Zwischenfall habe ich erst viele Jahre später von Jacek Pałasiński erfahren. Die antikommunistischen Oppositionellen fingen an, in Masuren nach einem grünen Volkswagen zu suchen. Sie wussten nur, es gab irgendwo in Masuren einen grünen VW-Bus mit deutschen Kennzeichen, aber erstaunlicherweise gelang es ihnen, ihn schnell zu finden und den fehlenden Teil abzuholen.
Die aus Berlin geschmuggelte Druckmaschine ging direkt in die Danziger Werft. Mir ihrer Hilfe wurden die ersten Aufrufe des Streikkomitees im August 1980 gedruckt. Jacek Pałasiński sagte mir mit einer gewissen Übertreibung: „Ohne dich hätte es Solidarność nicht gegeben.“ Das war natürlich sehr übertrieben.
Nachdem Sie 20 Jahre lang in Frankreich gelebt hatten, entschieden Sie sich 2002, nach Polen, nach Krakau zurückzukehren. Seit vielen Jahren unterrichten Sie in den USA, also verbringen Sie einen Teil des Jahres in Chicago. Ist es Ihnen nach der Rückkehr aus Frankreich gelungen, wieder Zugang zu dem polnischen gesellschaftlichen und kulturellen Leben zu finden und die Exilerfahrung hinter sich zu lassen? Oder spüren Sie eher eine Distanz gegenüber den polnischen Problemen, eine Distanz, die durch die regelmäßigen Aufenthalte in den USA noch verstärkt wird?
In der Tat: Ich bin zurück und teile größtenteils die polnische Leidenschaft für Politik. Aristoteles sagte einmal, nur Gott oder ein wildes Tier würde keiner Gemeinschaft angehören. Patriotismus bedeutet auch eine Zugehörigkeit zu einer Stadt im Sinne der griechischen Polis. Es ist die Sorge um meine Stadt, damit sie ehrlich, anständig, relativ wohlhabend bleibt, im Frieden, und nicht im Krieg lebt. Und das ist etwas, was den Menschen nicht genommen werden darf, und dessen verlogene Variante der Nationalismus darstellt, der sich auf die Überzeugung stützt, wir seien besser als die anderen.
Das gehört schon fast der Geschichte an, aber während PiS an der Macht war, mochte ich diese Regierung dermaßen nicht, dass ich beinahe krank wurde, als ich den Kaczyński-Brüdern zugehört habe mit ihrem unaufhörlich aggressiven, irritierten Ton. Es nahm mich sehr mit und in diesem Sinne bin ich in Polen gänzlich angekommen, denn diese Emotionen beschäftigten auch mich. Meine Aufenthalte in den USA sind jetzt kürzer, sie dauern zweieinhalb Monate. Obwohl Barack Obama ein Senator aus Illinois war, begeistert mich die amerikanische Politik nicht so sehr wie die polnische. George W. Bush irritierte mich auch nicht so stark wie Jarosław Kaczyński. Ich mag Amerika sehr, aber eher das Amerika der Bibliotheken als das Amerika des politischen Lebens.
Mit Adam Zagajewski sprach Dorota Danielewicz.
Das Gespräch erschien im deutsch-polnischen Magazin DIALOG Nr. 93