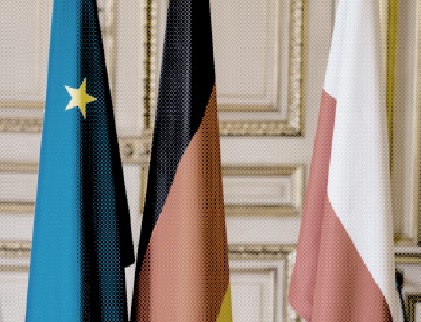Ein Gespräch mit Dr. habil. Magdalena Saryusz-Wolska über die Alexander von Humboldt-Stiftung, die Rolle von Wissenschaft in der postpandemischen, digitalen Gesellschaft sowie Erinnerkulturen in Polen und Deutschland. Das Gespräch entstand im Rahmen des virtuellen Humboldt-Kolloquiums zu Mittel- und Osteuropa am 23. und 24. September 2021 und wurde geführt von Ricarda Fait.
Ricarda Fait: Frau Dr. Saryusz-Wolska, Sie sind Humboldtianerin und Vertrauenswissenschaftlerin der Alexander von Humboldt-Stiftung in Polen. Was für eine Stiftung ist das und wie würden Sie Ihre Rolle und Aufgabe darin beschreiben?
Magdalena Saryusz-Wolska: Die Humboldt-Stiftung ist eine deutsche Stiftung, die aus Bundesmitteln gefördert wird und deren Aufgabe es ist, die deutsche und globale Wissenschaft miteinander zu vernetzen. Allerdings nicht nur, indem deutsche Wissenschaftlerinnen und Wissenschaftler ins Ausland reisen, sondern auch andersherum. Forscherinnen und Forscher aus der ganzen Welt werden eingeladen, um in Deutschland zu forschen. So kam auch ich in den Genuss eines Humboldt-Stipendiums.
Als Humboldt-Stipendiatin konnte ich 2019/2020 ein Jahr an der Johannes Gutenberg-Universität Mainz verbringen und dort die Forschung an meinem letzten Projekt beenden. Im Großen und Ganzen habe ich diese Zeit sehr genossen mit der kleinen Ausnahme, dass dann im Sommersemester die Corona-Pandemie begann und ich viele meiner Pläne, v.a. hinsichtlich des Networkings, nicht realisieren konnte.


Seit Januar 2021 bin ich Vertrauenswissenschaftlerin der Stiftung in Polen als Nachfolgerin von Prof. Katarzyna Marciniak. Die Stiftung hat keine eigenen Büros im Ausland, wie es viele andere Stiftungen oder Organisationen haben wie z.B. der DAAD, das Goethe-Institut oder politische Stiftungen. Da die Humboldt-Stiftung keine eigenen Büros in Warschau oder anderen Städten hat, bittet sie ausgewählte ehemalige Stipendiatinnen und Stipendiaten darum, die Stiftung im Ausland zu vertreten. Das ist eine ehrenamtliche Position – ehrenamtlich im doppelten Sinne des Wortes, weil es tatsächlich eine Ehre ist, die Stiftung zu vertreten, über sie und ihre Tätigkeiten zu informieren, die potenziellen Stipendiatinnen zu beraten usw.
Die Aufgabe ist umso wichtige, als wir bei der heutigen Online-Veranstaltung leider auch erfahren, dass die Anzahl der Kandidaten aus Polen aktuell nicht so groß ist. Im letzten Jahr hatten wir 22 Anträge und davon wurden 12 bewilligt. Das war schon sehr viel und das ist auch ein großer Erfolg, weil das weit über dem Durschnitt ist, aber andererseits gibt es aus anderen Ländern wie den USA weitaus mehr.
Die Stiftung verfolgt auch das Ziel, durch den wissenschaftlichen Austausch unter dem Stichwort „science diplomacy“ in die Öffentlichkeit hineinzuwirken. Wie ist Ihre Beobachtung – ist das eher ein hehres Ziel? Und wie beurteilen Sie das gerade auch vor dem Hintergrund der Pandemie, in der Politik und Gesellschaft derart stark auf wissenschaftliche Erkenntnisse angewiesen waren?
Ich beginne mit dem letzten Punkt, denn das mit der Wissenschaft in der Pandemie hat Vor- und Nachteile. Der Vorteil ist offensichtlich: Plötzlich sind Wissenschaftler Personen des öffentlichen Lebens und werden auch als solche wahrgenommen. Der Nachteil ist aber, dass die Gesellschaft ein Bild von der Wissenschaft bekommt, als sei sie zuallererst auf die Lösung aktueller Probleme orientiert. Das ist zu kurz gedacht.
Salopp gesagt: Wir hätten die Corona-Impfung nicht so schnell bekommen, wenn es nicht zuvor schon Forschungen dazu gegeben hätte, die ganz unscheinbar waren. Das heißt, man weiß nicht, wann irgendwelche Forschungsergebnisse vielleicht relevant sein könnten. Und nicht alles wird relevant. Es gibt viel Forschung, von der wir schon wissen, dass sie aller Voraussicht nach nie Einzug in unser praktisches Leben nehmen wird. Das betrifft die Geisteswissenschaften in einem sehr hohen Maße.
Inwiefern?
Wenn wir beispielsweise über die Geschichte des Mittelalters forschen, dann wird das unser Alltagsleben wahrscheinlich wenig beeinflussen. Ein Kollege von mir am Institut erforscht mittelalterliche Münzen. Wenn man so pragmatisch denkt, dass Wissenschaft zur Lösung aktueller Probleme beitragen soll, dann fragt man sich, warum sollte man den dann finanzieren?
Deswegen will ich betonen, dass die Wissenschaft uns helfen soll, die Welt zu verstehen. Das ist auch ein sehr wichtiges Ziel für die Geisteswissenschaften. Meine Forschung zum kulturellen Gedächtnis wird aller Voraussicht nach wenig Einfluss auf das kulturelle Gedächtnis selbst haben. Vielleicht werde ich in den einen oder anderen Beirat eingeladen und kann dort mit einer Idee zu einem Ausstellungsobjekt beitragen, aber im Großen und Ganzen wird das die Erinnerungskultur nicht verändern. Was ich aber beitragen kann, ist das: Verstehen zu vermitteln, wie die Erinnerungskultur funktioniert – wie sie produziert, rezipiert, politisch beeinflusst und missbraucht wird. Ob dabei ein pragmatischer Nutzen entsteht oder nicht, finde ich irrelevant.
Und das ist auch ein Ziel der Humboldt-Stiftung: Vorrangig geht es darum, Dinge aus unterschiedlichen Perspektiven zu verstehen, auch wenn sie keinen praktischen Nutzen haben. Und ich denke, daran müssen wir gesellschaftlich noch arbeiten.
Steht nicht gerade die historische Forschung wie auch das Ringen um die „richtige“ Erinnerung enorm im Fokus der Öffentlichkeit? In Polen gab es sogar einen Gerichtsprozess mit zwei Holocaust-Forschern – Jan Grabowski und Barbara Engelking. Auch wenn das Urteil im Berufungsverfahren wieder aufgehoben wurde – verändern solche Ereignisse die Forschung?
Natürlich. Allein die Tatsache, dass ich jetzt für ein Forschungsergebnis vor Gericht gezogen werden kann, ist eine Gefahr. Denn Wissenschaft muss erst einmal wissenschaftlich diskutiert werden – es gibt wissenschaftliche Standards, Rezensionen, Debatten. Es muss ein anderer akzeptierter Wissenschaftler nachweisen, dass ich einen Fehler gemacht habe und erst dann, wenn dieser Fehler wissenschaftlich nachgewiesen wurde, kann man diskutieren, ob dieser Fehler jemandem geschadet hat oder nicht.
Das ist übrigens in der Medizin auch nicht anders. Über medizinische Fehler diskutiert zuerst die Ärztekammer unter Experten. Und ich sehe keinen Grund, warum das in der Geschichtswissenschaft anders sein sollte, denn ein Strafverfahren ist eine völlig andere Sache. In diesem konkreten Fall war es eindeutig ein Vorwand, dass eine Kleinigkeit herausgezogen wurde, um die beiden Forscher zu kritisieren.
Welche anderen Herausforderungen sehen Sie noch für die Wissenschaft und die Gesellschaft in dieser postpandemischen Zeit?
Hinsichtlich der Pandemie beginne ich mit den negativen Folgen der Digitalisierung. Während die analoge Welt während der Pandemie schwer zugänglich war, haben wir uns alle zurückgezogen. In der Online-Welt leben wir allerdings in unseren digitalen Blasen und diese werden von Algorithmen gesteuert, die so programmiert sind, dass Gleichdenkende zusammengefügt werden. Natürlich wäre in der Pandemie ohne die Digitalisierung vieles nicht möglich gewesen, aber ich glaube, ein viel zu wenig diskutierter Nachteil ist, dass die sozialen Medien einen extremen Zuwachs erhalten haben. Das sieht man auch an den Gewinnen von Facebook, Google usw. im letzten Jahr.
Das waren die Gewinner der Pandemiezeit. Und diese Netzwerke funktionieren so, dass wir mit Menschen zusammengeschlossen werden, die so denken wie wir. Die mangelnde Konfrontation mit Andersdenkenden hat zur Folge, dass wir andere Meinungen oft gar nicht wahrnehmen. Wir sind nicht mehr im Stande, die Perspektive eines anderen einzunehmen.
Sollten diese Unternehmen und die sozialen Medien Ihrer Meinung nach stärker reguliert werden?
Von Regulierungen halte ich nicht sehr viel, denn ich denke, die Politik wird nie im Stande sein, den Entwicklungen zu folgen. Aber es ist immer noch so, dass wir die Mechanismen der sozialen Medien viel zu wenig verstehen, und zwar weil wir keine Daten und Quellen haben. Die Algorithmen werden stark geschützt und es mangelt an Transparenz.
Als Forscherin würde ich zum Beispiel gerne untersuchen, wie ein gewisser Algorithmus bestimmte historische Bilder zusammenfügt und wie sich die Erinnerungskultur dadurch verändert, aber ich würde nie im Leben ein Interview mit einer Person aus diesen Unternehmen bekommen. So können wir nur die Resultate erforschen, aber dabei sind wir dann natürlich immer fünf Schritte hinterher.


Haben Sie ein Beispiel für ein Geschichtsbild, das sich durch die digitalen Medien verhärten konnte?
Ich habe aus Forschungsgründen lange die rechtskonservative Presse in Polen gelesen, die ihre Inhalte natürlich nicht nur über Papierausgaben verbreitet, sondern vermehrt über Online-Ausgaben und soziale Netzwerke. So wurde z.B. das Bild der Flüchtlinge als Angreifer verbreitet, was visuell mit der Wehrmacht und dem Angriff auf Polen von 1939 verglichen wurde. Diese Bilder und Assoziationen gehen dann wahnsinnig schnell um die Welt und werden weitergeleitet.
Das hat alles einen enormen Einfluss darauf, wie wir über die Vergangenheit und die Gegenwart denken. Und auch auf das Leben und die Wahrnehmung dieser Geflüchteten – ob wir sie als Opfer eines Regimes oder potenzielle Angreifer wahrnehmen. Das alles hat sehr viel damit zu tun, wie unsere Erinnerungskultur digital vervielfältigt wird. Aber ich kann nur die Folgen untersuchen, ich habe keinen oder nur einen geringen Einblick in den Produktionsprozess.
Wenn es schon nicht transparent für die Nutzer ist, bräuchte es dann wenigstens mehr digitale „Aufklärung“ und Bildung? Vielleicht würde das dazu führen, dass Menschen kritischer mit sozialen Medien umgehen…
Wie die Menschen damit umgehen würden, weiß ich nicht, aber ich fände es fair zu wissen, was man in der Hand hat. Genauso wie Unternehmen verpflichtet sind, die Zutaten von Lebensmitteln auf ihren Produkten anzugeben, aber diese Transparenz fehlt in vielen anderen Bereichen. Das heißt, wir verkehren täglich mit sozialen Medien, ohne zu wissen, wie sie funktionieren.
Ich glaube, dass es insgesamt eher an dem Bedürfnis mangelt, zu verstehen, in was für einer Welt wir leben. Wir wollen, dass die Welt funktioniert, dass das Auto fährt, Zoom funktioniert etc. Aber wie das alles zustande kommt – dafür ist das Interesse wohl zu gering.
Auf der anderen Seite wird die Welt immer komplexer und schwerer zu überblicken…
Ja, aber in dem Moment, in denen manche Informationen nicht transparent gezeigt werden, ist es sehr leicht, sich mithilfe anderer Daten die Welt zu erklären. So entstehen Verschwörungstheorien. Und hier aufzuklären ist auch eine Aufgabe der Wissenschaftler, denn die meisten Forscherinnen arbeiten auch an Universitäten und haben dort einen Bildungsauftrag, dazu gehört auch, den zukünftigen Generationen beizubringen, fundierte Informationen von nicht fundierten Informationen zu unterscheiden, und das ist mitunter sehr komplex. Gerade heutzutage gibt es immer mehr Informationsquellen.
Wir haben erinnerungspolitische Entwicklungen in Polen betrachtet, ich möchte jetzt gerne noch den Blick auf Deutschland richten. Am 22. September wurde in Berlin nach langen Kontroversen das Humboldt-Forum feierlich eröffnet. Bundespräsident Steinmeier fand in seiner Rede zur Eröffnung sehr kritische Worte im Hinblick auf den Umgang mit dem Kolonialismus in Deutschland, der immer noch ein weißer Fleck in der Erinnerung sei. Er rief zu einer ehrlichen Debatte darüber auf, die im neuen Humboldt-Forum stattfinden müsse, damit es seinen Namen verdient.
Ich wäre nicht so streng wie Steinmeier. Die Debatte wird schon geführt, aber man kann darüber streiten, ob sie erstens früh genug initiiert – das ganz sicher nicht – und zweitens, ob sie ausreichend intensiv geführt wurde – wahrscheinlich auch nicht. Aber die Deutschen meckern immer auf einem sehr hohen Niveau.
In Polen sind kritische Auseinandersetzungen mit der eigenen Vergangenheit absolut unerwünscht. Es gibt zwar Debatten, aber sie erfahren nicht die gleiche öffentliche Aufmerksamkeit wie in Deutschland, bleiben eher auf einen kleineren Kreis und die Wissenschaft begrenzt. Wenn ich von Polen aus auf Deutschland blicke, dann bin ich schon etwas neidisch, dass diese problematischen Aspekte der eigenen Vergangenheit thematisiert werden, und zwar auf höchster politischer Ebene.
Aber um zum konkreten Fall zurückzukehren: In einer idealen Welt wäre das Humboldt-Forum ein erfolgreiches Projekt, wenn es nach mehreren Jahren leer stehen würde. Normalerweise ist der Auftrag eines klassischen Museums, so wie es Ende des 18. Jahrhunderts konzipiert wurde, Objekte zu sammeln. In diesem Fall wäre das Ideal, die Objekte nach und nach an ihre Eigentümer zurückzugeben, und das Humboldt-Forum würde symbolisch für diese Kehrtwende als leeres Gebäude stehen bleiben.
Natürlich ist das eine ideale Vorstellung, das ist mir klar, und ich verlange es auch nicht. Es ist aber unglaublich wichtig, diese Debatte zu führen. Außerdem möchte ich betonen, dass wir unter Kolonialismus wissenschaftlich heutzutage viel mehr als das Verhältnis zwischen den europäischen Metropolen und den Überseeregionen verstehen. Die ganze Besatzungsgeschichte in Osteuropa kann man auch als Kolonialgeschichte sehen, genauso wie die Teilungen Polens.
Der Begriff des Kolonialismus muss daher nicht nur in Bezug auf Deutschland, Europa und die Welt verwendet werden. Derartige Praktiken findet man auch innerhalb der jeweiligen Staaten – häufig in Bezug auf das Verhältnis von Stadt und Land oder von unterschiedlichen sozialen Klassen. In diesem Sinne ist es natürlich eine Debatte, die fortgeführt werden sollte und ich würde mir so eine Debatte auch in Polen wünschen.
Kommen wir nochmal auf die angesprochene Besatzungsgeschichte im Zweiten Weltkrieg zurück: Vor kurzem wurde das Konzept für den Ort des Erinnerns und der Begegnung mit Polen vorgestellt, der in Berlin entstehen soll. Dort soll u.a. an die Opfer des Zweiten Weltkriegs und der deutschen Besatzungszeit in Polen erinnert werden. Wie bewerten Sie das Konzept?
Zunächst muss ich sagen, dass ich über die Debatte in den letzten Wochen vielmehr in den deutschen als in den polnischen Medien gelesen habe. Das Echo in Polen war relativ gering. Vielleicht ist das ein Zeichen dafür, dass gewisse Initiativen schneller realisiert werden müssten. Anderseits glaube ich, dass bilaterale Ansätze das Geschichtsbild oft verzerren. Die Geschichte passiert nicht nur zwischen Polen und Deutschen, Deutschen und Franzosen, Türken und Griechen…
Man kann viele Denkmäler in Berlin bauen, dagegen spricht generell auch nichts, aber meine Befürchtung ist diese: Wenn wir viele bilaterale Projekte initiieren, dann besteht die Gefahr, dass der europäische und globale Kontext und das, was diese Geschichten verbindet – in diesem Fall die Gewaltgeschichte – irgendwann verloren gehen. Des Weiteren können bilaterale Ansätze leicht ein Bild von homogenen Nationalitäten vermitteln. Dabei sind gerade für die osteuropäischen Bevölkerungen mehrfache Identitäten sehr charakteristisch. Um das Konzept des neuen Erinnerungsortes in Berlin zu bewerten, müssen wir daher noch abwarten und sehen, wie es in der Praxis funktionieren wird.
Dann kommen wir am Ende noch einmal auf Alexander von Humboldt zurück. Ein Aphorismus von ihm lautet: „Der Mensch muss das Gute und Grosse wollen! Das Uebrige hängt vom Schicksal ab.“ Was wünschen Sie sich als Wissenschaftlerin für die Gesellschaft?
Das Leben lässt sich wie gesagt nicht in so strikte Kategorien trennen und tatsächlich hängt vieles vom Schicksal ab, wie die Pandemie gezeigt hat. Von daher würde ich mir wünschen, dass wir als Wissenschaftler, aber auch als Studierende und auch als Bürger bereit wären, mehr Wissen aufzunehmen, um die Komplexität unserer heutigen Welt besser wahrnehmen zu können. Einfache und klare Kategorisierungen machen zwar das Denken einfacher, sind aber problematisch, weil sie die Dinge in Gut und Böse teilen, in Pole – Deutscher, Frau – Mann etc. Doch die Welt ist nicht so einfach zu deuten.