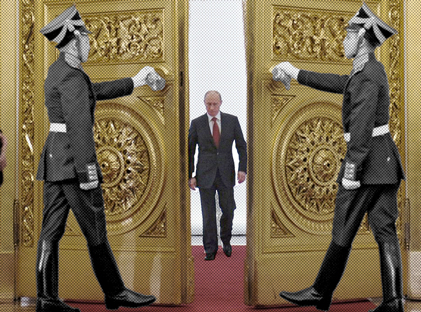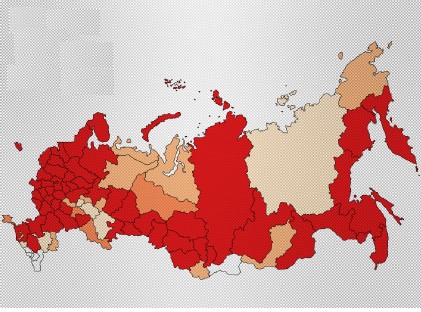Es gibt Bücher, die erst viele Jahre nach ihrem Erscheinen wirklich relevant werden. Der Gang der Ereignisse bringt es dazu, dass sie plötzlich wieder aktuell sind und ganz unerwartet Antworten auf die brennendsten Fragen der Gegenwart liefern. Zu diesen Büchern zählt Gerd Koenens „Der Russland-Komplex. Die Deutschen und der Osten 1900–1945“ (München 2005). Als das Buch zuerst erschien, stieß es kaum auf größeres Interesse. Doch für die Probleme der Gegenwart bietet es erstaunlich viele Erklärungen, die nicht nur in Deutschland von Wichtigkeit sind.
Gerd Koenen, Jahrgang 1944, ist ein geschätzter Publizist und Historiker, ist jedoch nicht an einer Universität tätig. Vielleicht sind seine Veröffentlichungen gerade deshalb literarisch so ansprechend und kommen ganz ohne den üblichen akademischen Jargon aus. Koenen ist in erster Linie für seine Arbeiten zur Geschichte des Kommunismus bekannt. Als sein Opus magnum gilt nicht ohne Grund sein mehr als eintausend Seiten langer Essay „Die Farbe Rot. Ursprünge und Geschichte des Kommunismus“ (München 2017). Koenen gehörte selbst als junger Mann marxistischen und maoistischen Gruppierungen an, begriff aber recht schnell, was sich hinter der Fassade der Gleichheitsideologie verbarg.
Der „Russland-Komplex“ ist eine gekürzte und umgearbeitete Fassung seiner Doktorarbeit von 2003. Die Untersuchung befasst sich mit dem nicht vollständigen halben Jahrhundert von 1900 bis 1945, einem relativ kurzen Zeitabschnitt vor dem Hintergrund der historisch sehr viel weiter zurückreichenden deutsch-russischen Beziehungen, während für die aktuellen Geschehnisse in der Ukraine die Entwicklungen nach 1989 eigentlich von größerer Bedeutung zu sein scheinen. Doch die Vorgänge des frühen 20. Jahrhunderts haben zweifellos die Art stark geprägt, wie Russland bis heute in Deutschland wahrgenommen wird.
„Rom oder Moskau?“, so heißt die eingangs in dem Buch gestellte Frage. Sie stammt von Alfons Paquet, einem der ersten westeuropäischen Publizisten, die über das damals bereits bolschewistische Russland nicht nur schrieben, sondern es auch bereisten. Die Frage ist eine Art roter Faden durch den „Russland-Komplex“; sie ist ein metaphorischer, gleichwohl unmissverständlicher Hinweis auf die Wahl, vor der sich Deutschland gestellt sah, ein der westlichen Zivilisation angehörendes Land, das aber direkt an den Osten grenzte. Übrigens bezieht sich Koenen hierbei auf die deutsche Geschichte Heinrich August Winklers unter dem vielsagenden Titel „Der lange Weg nach Westen“, die zu dem Schluss kommt, Deutschland habe sich bis 1945 eher vom Westen entfernt als sich ihm angenähert (S. 440). Mehr noch, was viele überraschen wird, habe die Reformation diese Entfernung noch vergrößert, indem sie die Verbindung zum „westlichen“ Rom geschwächt habe: „Während das Polnisch-Litauische Reich sich zur antemurale christianitatis gegen Moskowiter und Türken aufwarf, knüpfte das protestantische Deutschland am Ausgang der Religions‑ und Bürgerkriege des 16./17. Jahrhunderts seine aus den Zeiten der mittelalterlichen Ostkolonisation, der Hanse und der baltischen Ritterorden stammenden Verbindungen nach Russland von neuem an. Statt Waren exportierte das in Kleinstaaten zerfallene Deutschland über mehr als drei Jahrhunderte Menschen und Fachkenntnisse jeder Art, bis im 19. Jahrhundert die Auswanderung nach Amerika, in den ,wilden Westen‘, die nach Russland, in den ,wilden Osten‘, zu überflügeln begann“ (S. 441). Schließlich wurde selbst Russlands neue Hauptstadt St. Petersburg (gegründet 1703) mit einem deutschen Namen versehen. Russland wurde allmählich zum wichtigsten Partner Deutschlands: „Und so abfällig Friedrich II. [von Preußen] sich über die Russen äußerte (kaum viel misanthroper [sic!] allerdings als über die Deutschen), so entschieden formulierte er seine vom Trauma des Siebenjährigen Krieges und des ,Wunders seiner Rettung‘ diktierte Doktrin, wonach ,Russland … Preußens natürlichster Verbündeter‘ sei. Die Spur dieser Tradition reichte über die Bismarcksche Politik der Rückversicherung bis in die Zeiten des Vertrags von Rapallo und wurde selbst beim Hitler-Stalin-Pakt 1939 noch vielfach herbeizitiert“ (S. 442f.).

Die Art, wie Russland in Deutschland wahrgenommen wurde, war jedoch immer doppelbödig: Neben Hoffnungen, Interesse, ja Faszination gab es fast stets Befürchtungen, die sich manchmal bis zur Phobie auswuchsen. Dabei ist ein wohl wenig bekanntes Faktum, dass Marx und Engels zum Kreis der ausgesprochenen Russophoben zählten: „Ihr forcierter Versuch, den wilden Franzosenhass aus der Ära der Befreiungskriege […] nunmehr gegen das russische Zarenreich als mongoloid überformten Erobererstaat und angebliche Schutzmacht aller reaktionären Mächte Europas zu wenden, nahm schon früh die phantastischen Dimensionen eines revolutionären Kreuzzugs ,des Westens gegen den Osten, der Zivilisation gegen die Barbarei, der Republik gegen die Aristokratie‘ an […]“ (S. 443f.). Nach dem Untergang der Pariser Kommune änderten sie zwar ihre Meinung und setzten wachsende Hoffnungen auf die revolutionäre Gärung in Russland, doch war Marx trotzdem nicht gerade erbaut davon, dass die erste Übersetzung seines Kapitals“ ausgerechnet dort erschien. Trotzdem schien die Russland-Faszination zumindest gelegentlich die Oberhand über die Russophobie zu gewinnen.
Wenn wir einmal aus der heutigen, auch aus der polnischen Perspektive auf Koenens Buch blicken, besteht sein größter Wert darin, dass es diese Faszination in demjenigen Umfeld hervorragend diagnostiziert und erklärt, in dem sie auch heute noch verbreitet ist, und sie überdies dem größeren Kontext kultureller Entwicklungen und Tendenzen zuordnet.
Eine solche immer wieder in Erscheinung tretende Tendenz ist, wie sich das Land mit dem Westen abquält, wie es von seiner nachaufklärerischen Kultur der Rationalität enttäuscht und vor allem ihrer überdrüssig ist. So erschien Russland als intellektuelle Alternative für eine angeblich erschöpfte, demoralisierte, kaputte und absterbende westeuropäische Kultur. Koenen bemerkt hierzu: „Dabei glichen sich ,positive‘ und ,negative‘ Stereotypen vielfach aufs Haar oder unterschieden sich nur um Nuancen. […] Mal hatten die Russen den Nachteil ihrer Vorzüge und mal den Vorzug ihrer Nachteile. Wenn man sie […] für ,kindlich‘, ,ursprünglich‘, ,unverfälscht‘, ,träumerisch‘, ,lernfähig‘ und ,formbar‘ erklärte, für eine Spezies von Menschen, die dem Boden und der Natur wie den Urgründen der Seele oder des Unbewussten noch näher stünden und daher auf eine besondere Weise ,seelenhaft‘ und ,ursprünglich religiös‘ seien, so bleibt offen, ob das positive Zuschreibungen waren, oder ob sie nicht eher kultureller Herablassung und dem Wunsch nach imperialer Bevormundung entsprangen“ (S. 17).
Bei alldem hat es den Anschein, Russland werde hier in gewisser Weise rein instrumentell gesehen: Als Reservoir von Ideen, die einen „Aufstand gegen die Moderne“ (S. 19) entzünden könnten, und als Waffe im Kampf gegen die verhasste Kultur jenes nachaufklärerischen Westens. Es ist dabei sehr bezeichnend, dass die von Russland faszinierten deutschen Intellektuellen eine geheimnisvolle Wahlverwandtschaft zwischen beiden Nationen auszumachen glaubten: In seinen „Betrachtungen eines Unpolitischen“ erkannte Thomas Mann den „seelischen Konservativismus“ als Ausdruck der Verwandtschaft der russischen und deutschen Volksseele in ihrem Verhältnis zu Europa, zum Westen, zur Politik und zur Demokratie. Daher der höchst merkwürdige Traum von der „großen Synthese der Kulturen“, den Alfons Paquet (S. 31), Rainer Maria Rilke oder auch dessen Begleiterin auf seinen Reisen durch Russland, Lou Andreas-Salomé, mit sich trugen, und den kein anderer als Lew Tolstoj bei einer Begegnung mit diesen beiden bis zur Unerträglichkeit exaltierten Touristen im April 1899 verfliegen ließ. Hinter diesem russophilen Enthusiasmus verbarg sich nämlich ein oft für das frühe 20. Jahrhundert bezeichnender Kulturpessimismus, der von der überwältigenden Entwicklung von Industrie und Technik genährt war, die aber oft als Phänomen der „Dekadenz“ wahrgenommen wurde, des Endes einer vertrauten und gefahrlosen Welt. Umso mehr wurde in Russland „ein Jungbrunnen, rassisch wie politisch und spirituell“ gesehen, ein Antidotum „gegen das schon tief ins Blut gedrungene, vergiftende Westlertum“ (S. 327).
Unter diesen Voraussetzungen ist es kaum verwunderlich, dass vor allem der rechte Flügel des politischen Spektrums dieser Faszination erlag, also Menschen, die sich von ihrem Naturell her nach den guten, alten Zeiten sehnen, vor allem die extreme Rechte, die interessanterweise auch noch nach der Revolution der Bolschewiki vom Russentum fasziniert war; denn diese ließ die konservative Vorliebe für die tiefen Abgründe der „russischen Seele“ nur für einen Augenblick erkalten. Für viele polnische Anhänger des Staatsrechtlers Carl Schmitt war es gewiss eine Überraschung, als dieser von ihnen so sehr bewunderte konservative Denker Anfang der 1930er Jahre an der „Arbeitsgemeinschaft zum Studium der Planwirtschaft“ teilnahm; und in seinem Buch „Die Diktatur“ (1921), in dem Schmitt den Diktaturbegriff katholischer Staatsphilosophen wie Louis-Gabriel-Ambroise de Bonald, Joseph Görres und Juan Donoso Cortés untersuchte, bemerkt er mit unverhohlener Genugtuung, diese großen Katholiken hätten sich in den Einzelheiten ihrer Argumentation mit den Verfechtern der Diktatur des Proletariats getroffen (S. 344f.).
Nicht ohne Grund widmet Koenen dem heute wenig bekannten Eduard Stadtler etliche Seiten. Dieser begann kaum zufällig als katholischer Publizist und war in einer Jugendorganisation der katholischen Zentrumspartei tätig. Er verkündete, das französische Dogma der einzig erlösenden Demokratie sei eine fremde und falsche Staatsdoktrin, die aus dem deutschen nationalen Bewusstsein verschwinden werde (S. 233). Stadtler war während des Ersten Weltkriegs eine Zeitlang als Kriegsgefangener in Russland, auch noch nach dem bolschewistischen Umsturz. Anschließend war er in konservativen und rechtsextremen Organisationen wie dem Stahlhelm und der Deutschnationalen Volkspartei aktiv. Er war ein begeisterter Anhänger Mussolinis und der italienischen Faschisten und Mitglied der „Gesellschaft zum Studium des Faschismus“. Öffentlich trat er als unversöhnlicher Feind des Bolschewismus in Erscheinung, gründete gar einen Verein mit dem Namen „Antibolschewistische Liga“, doch…
Bereits während seines Zwangsaufenthalts in Russland begeisterte sich Stadtler für einen „typischen Russen“ „von jener urwüchsig gesunden, unverdorbenen Art, wie sie bei Naturvölkern oft anzutreffen ist: primitive Liebe, primitiver Hass und Ehrfurcht vor dem ,höheren‘ Wesen“ (Eduard Stadtler, Als politischer Soldat 1914–1918, Düsseldorf 1935, S. 66f., zit. S. 234). Selbst seine späteren Texte und Vorträge, in denen er vor den „Bolschewiken“ warnte, sind nicht frei von unverhohlener Faszination für die siegreiche, dem Westen feindliche revolutionäre Bewegung, vor allem aber nicht frei von Bewunderung des „Genies Lenins“ (S. 238). Denn auch Stadtler, wie überhaupt in Deutschland vielen, schwebte eine Diktatur eines parteilosen, mächtigen Mannes vor; Koenen legt nahe, dass Stadtler, anders als Schmitt, der bereit war, sich mit der Rolle eines Beraters und „Anleiters“ eines solchen „Führers“ zu begnügen, selbst nicht abgeneigt war, in die Rolle dieses „mächtigen Mannes“ zu schlüpfen.
Um 1920 machten sich in Stadtlers Rhetorik neue Töne vernehmbar. Nunmehr war er bereits imstande, sich eine Art taktischen Bündnisses mit Sowjetrussland vorzustellen, das sich den „senilen Herrenvölkern“ des europäischen Westens sowie – wie hätte es anders sein können – der fortschreitenden „Amerikanisierung“ Deutschlands entgegenstellen solle. „Die Macht des Ostens ist gewaltig. Sowjetrussland steht außenpolitisch in voller Rüstung da. Es spottet der ganzen Welt und wird von der ganzen Welt gefürchtet.“ Was Stadtler dabei ungeheuer imponierte: „Dort [in Russland] regiert zudem ein Herrscher. Der einzige in Europa … Seine Genialität ist fast übernapoleonisch […]“ (zit. S. 329). Stadtlers Enthusiasmus für Russland und Lenin führte dazu, dass er in NS-Deutschland geheimdienstlicher Überwachung unterworfen wurde, und obwohl er schließlich der NSDAP beitrat, machte er keine große Karriere. Doch ist bemerkenswert, dass selbst Hitler nicht ganz frei von solchem Enthusiasmus war: „Was Hitler betraf, so sind nicht nur seine zahlreichen bewundernden Äußerungen bei Tisch oder im Führerhauptquartier über die ,Genialität‘ und ,Konsequenz‘ Stalins bekannt, den er als einen nationalen Diktator eigenen Ranges anerkannte“ (S. 422). In einem Brief an Mussolini vom März 1940 stellte der „Führer und Reichskanzler“ mit Genugtuung fest, das sowjetische Regime habe sich vom „internationalen Bolschewismus zu einem russischen Nationalismus“ entwickelt (ebd.).
Koenen widmet dem Einfluss der russischen Kultur in Deutschland breiten Raum. „Ein neuer Russland-Mythos nahm mit der Jahrhundertwende Gestalt an, worin das unverbildete, tiefgläubige, naturnahe, vielseitig begabte, aber grausam beleidigte, zwischen Verbrechen und Buße, Aufruhr und Vergebung schwankende russische Volk und seine großen Dichter und Künstler das eigentliche, ,wahre Russland‘ repräsentierten, das seine Zukunft und Entfaltung erst noch vor sich hatte. Sozialdemokratische Kritiker sprachen zehn Jahre vor dem Weltkrieg bereits missbilligend von einem regelrechten ,Russenkultus‘ in den deutschen Feuilletons“ (S. 44). Der junge Rainer Maria Rilke, der Russland zweimal besuchte, 1899 und 1900, gelangte gar zu dem Schluss, Russland grenze an Gott, Thomas Mann nannte in „Tonio Kröger“ die russische Literatur „heilig“, Ernst Barlach begeisterte sich während seiner Wanderungen durch Russland für den einfachen russischen Menschen, und Christian Morgenstern „besang die russischen Gefangenen nach der Niederschlagung der Revolution [von 1905] als Vorkämpfer und Märtyrer einer künftigen Menschheit“ (S. 45). Für viele deutsche Intellektuelle blieb Russland der geistige und spirituelle „Jungbrunnen“ (S. 327).
Für die Vermittlung der die Deutschen so sehr beeindruckenden russischen Geistigkeit spielten Fjodor Dostojewskijs Romane eine zentrale Rolle. Der Verfasser der „Dämonen“ wurde in Deutschland Anfang des 20. Jahrhunderts geradezu zum Kultautor. Thomas Mann verkündete gar die „Herrschaft Dostojewskis über die europäische Jugend von 1920“ (zit. S. 350), Siegmund Freud hielt die „Brüder Karamasow“ für den „großartigsten Roman, der je geschrieben wurde“ (zit. S. 437), und die Slawistin Sonia Lane befand 1931, der russische Schriftsteller sei „zum innersten Bestandteil der deutschen Kultur, des deutschen Geistes – und der deutschen Nervosität geworden“ (zit. S. 351).
Koenens Befunde erklären heute erstaunlich viele, dem Anschein nach unverständliche, Sachverhalte. Sie machen vor allem begreifbar, woher die erstaunliche Liebe zu Russland und Wladimir Wladimirowitsch im Umfeld der extremen Rechten und des fanatischen Katholizismus stammt. Es ist kein Zufall, dass sich dergleichen Emotionen zum wiederholten Male zeigen, und der von Lenins Genie begeisterte Eduard Stadtler, Matteo Salvini im T-Shirt mit dem Bild des russischen Präsidenten oder Adam Wielomski [polnischer Politologe und rechtsgerichteter Politiker; A.d.Ü.], der in Wladimir Wladimirowitsch den letzten europäischen Verteidiger „christlicher Werte“ entdeckt und einen „Katechon [!], der sein Land kühn in die Zukunft führt“, dem „amerikanischen Establishment“ zum Trotz, das um seine „Suprematie“ besorgt sei – sie sind im Grunde Reinkarnationen derselben Gestalt. So wird auch die merkwürdig zögerliche Haltung Papst Franziskus’ verständlich, der immer noch nicht zu wissen scheint, wer den Krieg in der Ukraine verursacht hat, und „alle“ dafür verantwortlich macht. An dieser Stelle wäre vielleicht zu der einst von Alfons Paquet gestellten Frage zurückzukehren und sie einer gewissen Verjüngungskur zu unterziehen: Heute klänge sie wohl eher nach einer Feststellung: „Rom oder Moskau“. Eine Übertreibung? Nicht unbedingt. Schließlich wollte Moskau immer schon das „Dritte Rom“ sein. Aber das ist dabei nicht das Wichtigste. Um wirklich zu verstehen, was heute in Europa vor sich geht, ist der Versuch anzustellen, die unterschiedlichen Phänomene auf ihren kleinsten gemeinsamen Nenner zurückzuführen. Denn in Wirklichkeit prallen in der Ukraine nicht nur zwei nationale Armeen aufeinander, sondern zwei Zivilisationen: Die Zivilisation der Masse und die Zivilisation des Individuums. Bei diesem Zusammenprall scheinen sich der römische Katholizismus wie die extreme Rechte ziemlich eindeutig für erstere auszusprechen, und zwar nicht erst seit Ausbruch des russisch-ukrainischen Kriegs. Das ist nicht weiter überraschend: Das katholische Rom hat sich nie vorbehaltlos mit der Idee der Menschenrechte und der individuellen Freiheit angefreundet, denn das setzt schließlich auch die Freiheit von Religion voraus, die Befreiung der Schafe von der Macht der Hirten. Betrachten wir die Schriften des Zweiten Vatikanischen Konzils aufmerksam, stellen wir fest, wie nur zum Schein und beinahe zwischen den Zähnen zugestanden die „Erklärung zur Religionsfreiheit“ war, welche die Enzyklika „Dignitatis humanae“ (1965) bringt. Franziskus als letzter europäischer absoluter Herrscher, dessen Herrschaft über Millionen Katholiken nur noch einen frustrierend formalen Charakter beibehält, steht Putin bedeutend näher als der „Russlands Bäume ankläffende“ Westen.
Es ist übrigens nicht auszuschließen, dass die Zivilisation der Masse dem Wesen nach dem Homo Sapiens nähersteht als die Zivilisation des Individuums, welche in der Menschheitsgeschichte eigentlich doch nur ein einziges Mal in Erscheinung trat: im nachaufklärerischen Europa. Gewiss sind daher die Bewunderer der „russischen Seele“ davon so gequält und gelangweilt, welche letztere der Natur näher sei und nicht von den europäischen Giften verdorben; diese träumen, wie einst Rilke in seinen Briefen an Aurelia Gallarati-Scotti, von einer Gesellschaften der „Demütigen“, welche die unwahre Freiheit abwerfe, die „Krankheit der Welt“, und den „stolzen Gehorsam“ wähle, der sich in der „Demut“ äußere, die so charakteristisch für das fromme Volk Russlands sei, sowie im Einverständnis mit einem „maßvolle[n] Regime, das Heilmittel, das immer Autorität einschließt, zeitweilig eine gewisse Gewalt und den Verlust der Freiheit“ (Rainer Maria Rilke, Briefe in zwei Bänden, hg. v. Horst Nalewski, Frankfurt/M., Leipzig 1991, Bd. 2, S. 392ff.).
Koenens Buch kann daneben einen Beitrag zu der aktuell heftig um die Frage geführten Diskussion leisten, ob unter den gegebenen Umständen noch etwas zur Verbreitung russischer Kultur geleistet werden solle. Nach meinem Eindruck setzt sich hierbei eine Position durch, die sich auf die bündige Formel bringen ließe: „Putin nein, Dostojewskij ja.“ Koenen untersucht das Phänomen der deutschen Dostojewskij-Manie mit großer Aufmerksamkeit und zitiert Hannah Arendt, die in ihren „Elementen und Ursprüngen totaler Herrschaft“ scharfsinnig beschreibt, wie in „der bewunderungswürdigen“ (nach einem Ausdruck von Thomas Mann) russischen Literatur verborgenes Gift wirkt: „Einem politisch unbefangenen Beobachter mochte es […] erscheinen, daß die ,östliche Seele‘ undendlich reicher, ihre Psychologie unendlich komplizierter und ihre Literatur unendlich tiefer sei als die der westlichen Völker der gleichen Periode [d.h. der Zeit um 1900; A.d.Ü.]“ (Hannah Arendt, Elemente und Ursprünge totaler Herrschaft, dt. Erstausgabe 1955, München 1986, 23. Aufl. 2021, S. 521). Jener „politisch unbefangene Beobachter“ schenkte den russischen Autoren und ihren deutschen Propagatoren bereitwillig Glauben, die Frömmigkeit sei tief in der Seele des unglücklichen russischen Volkes verwurzelt, wodurch es alle anderen Völker überrage; das ausgerechnet solle Russland von den „zivilisierten Ländern“ unterscheiden, die schwer an ihrer flachen Langeweile und oberflächlichen Banalität trügen. Arendts Schlussfolgerung ist eindeutig: „Auch übten die durch die Oktoberrevolution exilierten russischen Intellektuellen einen nicht geringen Einfluß auf das geistige Leben der zwanziger Jahre aus, das rein stimmungsmäßig totalitären Bewegungen nur günstig sein konnte“ (ebd., S. 523f.). Wie sich dem zufügen ließe, schrieb übrigens etwas sehr Ähnliches bereits in den 1920er Jahren Marian Zdziechowski, der in seinen „Russischen Einflüssen auf die polnische Seele“ (Wpływy rosyjskie na duszę polską, Kraków 1920) warnte: „Die geistige Russifizierung, wie sie sich im Kult der sich nach dem Absoluten sehnenden russischen Seele offenbart, die sich durch nichts auf der Welt sättigen lässt, bildet nur das Vorspiel zur politischen Russifizierung.“
Eine Warnung, die heute aktueller ist denn je.
Wo nicht anders angegeben, Zitate aus: Gerd Koenen, Der Russland-Komplex. Die Deutschen und der Osten 1900–1945, München: Beck, 2005, 2. Auflage 2019
Aus dem Polnischen von Andreas R. Hofmann