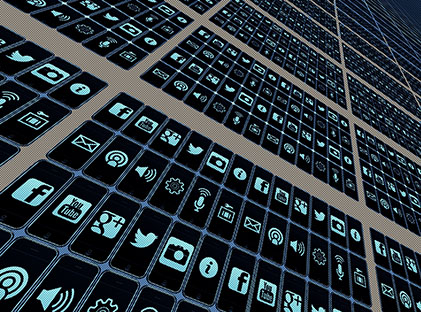Deutschland hat eine neue Spiegel-Affäre. Wie 1962 könnte diese Affäre das Land verändern – oder zumindest die Position des Journalismus in der Gesellschaft. Auf dem Spiel steht der Ruf des Hamburger Nachrichtenmagazins und damit die Glaubwürdigkeit einer Profession, die den Spiegel seit seiner Schlacht gegen Franz Josef Strauß als „Sturmgeschütz der Demokratie“ (Rudolf Augstein) feiert. Strauß musste damals als Verteidigungsminister zurücktreten, und der Begriff Spiegel-Affäre wurde ein Synonym für die Pressefreiheit in der alten Bundesrepublik. Redakteuren Landesverrat vorwerfen, weil sie die Politik der Regierung und hier vor allem die Ausstattung der Bundeswehr kritisieren („Bedingt abwehrbereit“): Das wollte sich die Öffentlichkeit seinerzeit nicht gefallen lassen.
Die neue Spiegel-Affäre trägt den Namen eines jungen Mannes. Dem Journalisten Claas Relotius wird vorgeworfen, Menschen und Geschichten erfunden zu haben. Dieser Relotius ist nicht irgendwer. Er hat zahlreiche Preise gewonnen – unter anderem seit 2013 allein viermal den Deutschen Reporterpreis (davon dreimal für die beste Reportage). Kurz vor Weihnachten hat sich seine Redaktion öffentlich von ihm losgesagt. Die Überschriften dieses langen Textes von Ullrich Fichtner, Abteilungsleiter und einer der Mentoren von Relotius: „Manipulation durch Reporter. Spiegel legt Betrugsfall im eigenen Haus offen. Rekonstruktion in eigener Sache“. An seinem Schützling lässt Fichtner dort kein gutes Haar. Relotius, der Fälscher, zähle „offenbar nicht zu den normalen Menschen“ und brauche „wohl einen Arzt“. Botschaft: Ein Einzelner kann krank sein, überall. Aber nicht das System.
Dass die neue Spiegel-Affäre personalisiert wird, ist ein Ablenkungsmanöver. Claas Relotius hat nichts weiter verbrochen, als die Spielregeln zu verinnerlichen, die im Moment im deutschen Journalismus gelten. Dass er diese Regeln besonders virtuos beherrscht, haben ihm zahlreiche Jurys und Laudatoren bescheinigt. Selbst die Grenze, die er überschritten hat (Personen und Begebenheiten schildern, die es so nicht gibt oder nicht gegeben hat – ein Vergehen, das sich nicht wegdiskutieren lässt und das in jedem Fall zu verurteilen ist), wird nicht von jedem Lehrbuch als Grenze gesehen. Einen roten Faden spinnen, das Weglassen, was nicht dazu passt, und aus „vier, fünf individuellen Geschichten“ einen „typischen Fall“ bauen, „um das Exemplarische zu zeigen“: Nicht wenige angehende Journalisten haben im Standardwerk „Die Reportage“ von Michael Haller gelesen, wie sie am Ende zu Preisen kommen. Um Missverständnissen vorzubeugen: Der Journalismusforscher Uwe Krüger, ein Schüler von Haller, hat in der Tageszeitung Neues Deutschland darauf hingewiesen, dass sein Lehrer „stets das peinlich genaue Prüfen der Fakten anmahnt“ und dass es ihm nie darum gegangen sei, über eine „Typisierung“ die „Wirklichkeit“ zu verfälschen. „Sagen, was ist“ (Rudolf Augstein“): nur eben zugespitzt und auf den Punkt gebracht.

Damit sind wir dort, wo es spannend wird: bei den Selektionsmechanismen im Journalismus, bei seiner Berufsideologie und bei den Medienstrukturen – bei den Rahmenbedingungen, unter denen Reporter wie Claas Relotius heute arbeiten. Dass die neue Spiegel-Affäre seinen Namen trägt, verhindert eine öffentliche Debatte über die Qualität des Journalismus. 1962 hat sich die Gesellschaft darüber verständigt, was sie von diesem Beruf erwartet und welchen Preis sie dafür zahlen möchte (zum Beispiel einen Ministerrücktritt). Heute zeigt die Branche auf Personen und klopft sich danach auf die Schultern. Funktioniert doch, unsere Selbstkontrolle. Wir finden die schwarzen Schafe. Nach Relotius hat es zum Beispiel Fernsehleute im öffentlich-rechtlichen Rundfunk getroffen, die Personal für ihre Sendungen gecastet haben, oder einen (ebenfalls preisgekrönten) Autor, der dem Magazin der Süddeutschen Zeitung eine Fake-Geschichte angeboten hatte. Allesamt Freiberufler, umgehend entsorgt.
Die Geschichte dieser gefallenen Engel geht ans Eingemachte. An die Fiktion, der Journalismus könne so etwas wie ein Spiegel der Realität sein oder gar objektiv. Lieber einzelne Kolleginnen und Kollegen der Verdammnis preisgeben als an dieser Fiktion rütteln. Dann müsste man über Quellen reden, über die Interessen der Mächtigen und über den Druck, den sie ausüben. Dann müsste man darüber reden, wie man die Geschichten weiterdreht, die schon da sind. Wie man Klicks und Aufmerksamkeit generiert. Ohne Erfindungen, meistens. Aber so groß ist dieser Unterschied gar nicht.
Massenmedien erzeugen das „Gedächtnis“ der Gesellschaft, sagt der Soziologe Niklas Luhmann. „Sagen, was ist“: Dieses Motto des Spiegel-Gründers Rudolf Augstein stimmt, aber vermutlich hat er es anders gemeint. Medien definieren, was ist. Sie ordnen die Welt und liefern die Kategorien, mit denen wir die Welt beschreiben können. Gedächtnis der Gesellschaft oder „Hintergrundwissen“ (ein anderer Luhmann-Begriff): An dem, was Medien sagen, kommt niemand vorbei, weil wir unterstellen müssen, dass alle anderen das gleiche gesehen, gelesen, gehört haben. Medienrealität ist eine Realität erster Ordnung. Von der Medienrealität geht eine symbolische Gewalt aus, der sich auch diejenigen nicht entziehen können, die nichts von dieser Realität halten und schon gar nicht an sie glauben.
Niklas Luhmann war egal, wie die Medienrealität aussieht. Systemtheoretiker wie er kennen das Prinzip Ursache-Wirkung nicht. Wie das System Massenmedien Reize von außen verarbeitet (aus der Politik zum Beispiel oder aus der Wirtschaft), ist kontingent. Vielleicht so, vielleicht aber auch anders. Für die Funktion des Systems spielt das auch keine Rolle. Ob wir Heldensagen im Gedächtnis der Gesellschaft haben, Göttergeschichten oder Parteiskandale, ist aus dieser Perspektive einerlei. Hauptsache wir wissen, dass die anderen über die gleichen Themen sprechen können.
Nicht egal ist das all denen, die von öffentlicher Aufmerksamkeit und öffentlicher Legitimation leben. Wirtschaft, Politik, Profisport. Dort wird das Gedächtnis der Gesellschaft gefüttert. Mit Fakten versteht sich. Mit Menschen, Events und Zitaten, die die Dokumentarin beim Spiegel wiederfinden kann.
Nicht egal ist die Medienrealität natürlich auch denen, die sie produzieren. Sie kann ihnen nicht egal sein, weil sie davon leben. In Deutschland heißt das für die allermeisten Journalistinnen und Journalisten: Aufmerksamkeit, Aufmerksamkeit, Aufmerksamkeit. Exklusives, Unerhörtes, Spektakuläres. Menschen, die gut aussehen. Geschichten, die man so noch nicht gehört hat. Solche Menschen und solche Geschichten werden jeden Tag „erfunden“, in jeder Redaktion. Selbst die Leitmedien spitzen längst zu und emotionalisieren, wenn sie über Politik oder Wirtschaft berichten. Sie vereinfachen, personalisieren, psychologisieren. Merz gegen Spahn gegen Kramp-Karrenbauer. Und die Parteien „liefern“.
Was heißt das alles für den „Fall“ Relotius? Der Journalismus hat erstens ein Interesse am Mythos vom kranken Einzeltäter. Sonst müsste er anfangen, seine Berufsideologie auf den Prüfstand zu stellen. Objektivität, Trennung von Nachricht und Meinung, Neutralität, Unabhängigkeit, Ausgewogenheit: Solche Kriterienkataloge sind verräterisch, weil sie etwas versprechen, was niemals einzulösen ist, und so die Selektivität verdecken, die jede Berichterstattung ausmacht. Zweitens können wir trotzdem oder gerade deshalb anfangen, ganz neu über Qualität im Journalismus nachzudenken. Über Transparenz zum Beispiel.
Sagen, von wem die Fakten stammen und wem sie vermutlich helfen werden. Sagen, wer man selbst ist und wie man zu dem Thema kam. Auch sagen (wenn man es denn kann), wer dafür gesorgt hat, dass diese Fakten Medienrealität geworden sind und andere nicht. Und drittens muss es um das Mediensystem als Ganzes gehen. Kommerz führt zur Aufmerksamkeitsspirale führt zu Relotius. Wenn man das zu Ende denkt, dann heißt die Lösung nicht noch mehr Faktencheck, sondern Medienfreiheit. Medien, die davon befreit sind, ein Geschäft zu sein. Medien, die so frei sind, dass sie den Herrschenden ungestraft widersprechen können (zum Beispiel dem Verteidigungsminister). Medien, die sichtbar machen, was die Mächtigen gern unsichtbar machen würden. Wie Der Spiegel im heißen Herbst 1962.