Politisch ist Ostmitteleuropa zu einem düsteren Ort geworden. Dabei haben Intellektuelle in Polen, Ungarn und der Tschechslowakei den Gegenentwurf schon in den 1980ern formuliert. Michal Hvorecký (Bratislava) erinnert an die Kraft von Gesellschaften mit Visionen.
Liebe Tereza, liebe Monika, lieber Marton,
neulich habe ich all unsere bisherigen Kolumnen nochmal durchgelesen und mich gefragt, warum wir so vieles in unseren Ländern so dermaßen düster zeichnen. Ich erinnerte mich an die prophetischen Visionen der mitteleuropäischen Intellektuellen und Dissidenten aus den 1980er Jahren. Damals haben György Konrád in Budapest, Milan Kundera in Paris, Václav Havel in Prag und Czesław Miłosz in Berkeley einen überraschenden und wichtigen intellektuellen Ansatz verfolgt, mit dem sie auf die Spaltung Europas nach dem Zweiten Weltkrieg reagierten.
Ihre Visionen und ihre politischen Positionen waren zwar ziemlich unterschiedlich, aber alle glaubten an Mitteleuropa – und daran, dass dieser europäische Kern seine vermittelnde Funktion zwischen Ost- und West wahrnehmen soll. Was die vier oppositionellen Intellektuellen aus Ungarn, der Tschechoslowakei und Polen auch verband, war das Bewusstsein, dass ihre Länder ganz klar zum westlichen Kulturkreis gehörten.
Sie wollten, dass der Westen die historischen Landschaften zwischen Ostsee und Adria wieder als genuin europäisch wahrnimmt, was inmitten des Kalten Krieges kaum der Fall war. Die mentale Orientierung an Berlin, London oder Rom kreierte einen der Pfeiler des osteuropäischen demokratischen Protests gegen die von der Sowjetunion gesteuerten totalitären Regime.
Die Akteure der Mitteleuropadebatte glaubten an die Integration ihrer Gesellschaften ins freie europäische Wertesystem und kämpften in Untergrund- oder Exilzeitschriften gegen die Ideologen der Diktatur. Ein Mitteleuropäer war für Konrád, „wer die Teilung Europas für ein künstliches Gebilde hält (…). Mitteleuropäer sein ist eine Haltung, eine Weltanschauung, eine ästhetische Sensibilität für das Komplizierte, die Mehrsprachigkeit der Anschauungsweisen“. Für Kundera bedeutete Mitteleuropa die „größtmögliche Vielfalt auf dem kleinsten Raum“ gegenüber „geringster Vielfalt auf dem größten Raum“ – wie es in der UdSSR der Fall war.
Nach dem Fall der Berliner Mauer hat sich dieses Mitteleuropa tatsächlich entwickelt – vorläufig. Viele Hoffnungen und Vorstellungen wurden durch EU- und NATO-Beitritt der mittel- und osteuropäischen Staaten zur Realität. Die Verträge von Jalta und Potsdam wurden dabei nominell überwunden. Heute allerdings scheinen sie – wenn man sich Russlands Gebaren an den Fronten des Informationskriegs näher anschaut – zumindest informell weiterhin bindend.
Zwischen den Samtenen Revolutionen 1989 und der Flüchtlingskrise 2015 lag ein Vierteljahrhundert trügerischer Ruhe. Heute driftet Ostmitteleuropa wieder gen Osten, besser gesagt, es wird verschleppt von Rechtspopulisten – zuweilen in Regierungsverantwortung – die ihrer eigenen Agenda folgen, in die eigene Tasche wirtschaften, den moralischen Bankrott ganzer Zivilgesellschaften fördern und die Bürger massiver Gehirnwäsche unterziehen.
Ich vermisse das Ideal eines Mitteleuropas, das vermitteln und verbinden wollte. Ich liebte es, und ich will mich heute nicht für mein Land schämen müssen. Die neue Teilung der EU entlang nationalstaatlicher Egoismen und rechtspopulistischer Idiotie verletzt und beunruhigt mich zutiefst.
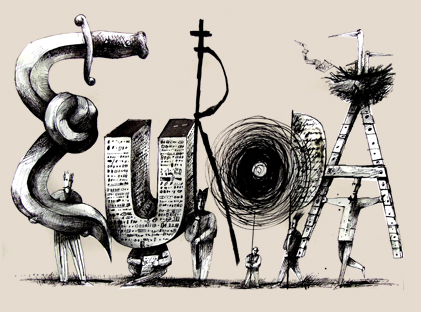
Denn: Ostmitteleuropa hat viel mehr zu bieten als autoritäre Populisten, Hassprediger, fundamentalistische Gläubige oder wütende Rechte. Viele aktive BürgerInnen bemühen sich intensiv darum, Košice, Brno, Debrecen oder Wroclaw modern und zukunftsfähig zu machen. Die Theater- und Kunstszene arbeitet auf hohem Niveau, die Clubszene wächst, Literatur wird geschrieben und gelesen, politische Diskurse werden initiiert. Und der Wirtschaft geht’s auch ganz gut. Früher wollten alle immer nur weg, heute ist das anders, vielen kehren zurück, um eine bessere Stadt oder bessere Region zu schaffen, sie gründen Start-Ups, bevölkern Co-Working Spaces, wissenschaftliche und kulturelle Hubs.
Wie es richtig geht, zeigt Estland. Dort kann man mit der elektronischen Bürgerkarte (die inzwischen 98 Prozent der Esten nutzen) online wählen, Banküberweisungen erledigen, sich versichern, in drei Minuten die Steuererklärung machen und in einer Viertelstunde ein neues Unternehmen registrieren. Diese Innovationen sind nicht aus Überfluss, sondern aus Armut entstanden, weil sich das heruntergekommene baltische Land keinen großen Staatsapparat leisten konnte.
Die notwendige Transparenz, wer wann auf welche Daten im durchdigitalisierten estnischen Staat Zugriff hat, hilft auch dabei, die Korruption zu bekämpfen. Nach Estland verlegen Hunderte Ausländer ihren virtuellen Wohnsitz, das Land öffnet sich für Fremde und Unbekannte.
Warum ist die Kluft zwischen Estland und V4-Staaten in den vergangenen Jahren immer größer geworden? Wie bringen wir den analogen und schwerfälligen öffentlichen Sektor ins digitale Zeitalter? Vielleicht könnte Cyber-Ostmitteleuropa mehr Selbstverständnis und Vertrauen schaffen und zur Akzeptanz der offenen Gesellschaft beitragen. Ostmitteleuropa wird noch gebraucht, es hat jetzt eine Chance, die wir nutzen müssen, anstatt sie auf dem Altar von Rechtspopulismus und Resignation zu opfern.
Dieser Beitrag erschien ursprünglich auf ostpol.de, dem Osteuropa-Magazin von n-ost, in der Kolumne Gemischtes Doppel Visegrád, in der sich vier AutorInnen wöchentlich zu den Diskursen ihrer Länder äußern.









