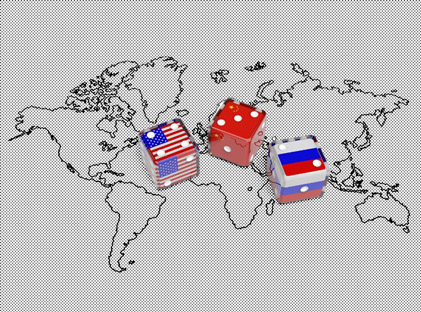Im Schatten des großen Handelskriegs zwischen den Vereinigten Staaten und der Volksrepublik China versucht einer der globalen Akteure, auf vielen Hochzeiten zugleich zu tanzen. Die deutsch-chinesischen Beziehungen sind von besonderer Art und blicken auf eine lange Geschichte zurück. Legen sich die jüngsten Entwicklungen wie ein Schatten zwischen die beiden Partner, die doch seit mehr als einhundert Jahren miteinander in Kontakt sind?
Tanz auf vielen Hochzeiten
Die Anfänge der neueren deutsch-chinesischen Beziehungen in Politik und Wirtschaft gehen auf das ausgehende 19. Jahrhundert zurück, als das von vielen inneren und äußeren Problemen zerrüttete China erst mit den Opiumkriegen und dann der Revolution von 1911 zu tun hatte. Während Chinas Verhältnis zu den damaligen Großmächten wie insbesondere dem britischen Empire, aber auch Japan zahlreichen Wechselfällen unterworfen war, galt Deutschland so wie heute immer noch als bevorzugter und vor allem verlässlicher Partner.
Reichskanzler Otto von Bismarck schuf die eigentlichen Fundamente für die deutsch-chinesischen Beziehungen, wenn auch die ersten Handelsmissionen China auf dem Weg über Sibirien bereits im 18. Jahrhundert erreicht hatten. Um ein Gegengewicht gegen die Vormacht des britischen Empire in der Region zu finden, begann Bismarck, in Asien einen deutschen Brückenkopf zu errichten. Der erste Schritt dazu war ein Reichstagbeschluss von 1885, eine Seeroute nach China aufzubauen.

Im Jahr darauf begab sich eine erste Wirtschaftsdelegation aus Bankkaufleuten und Industriellen nach China. Sie wurde sehr freundlich aufgenommen, wofür die Gastgeber ein klares Motiv hatten: Sie wollten ihr Land modernisieren. Das Kaiserreich China suchte dringend den Anschluss an die Moderne, und die Deutschen konnten dabei helfen, was auch so geschah. Weitere Handelsmissionen schufen die Voraussetzungen für die Gründung der Deutsch-Asiatischen Bank in Shanghai, welche deutsche Unternehmen mit Krediten versorgte, bis Deutschland 1896 neben Großbritannien zum wichtigsten europäischen Handelspartner wurde.
Die wichtigsten Felder der deutsch-chinesischen Zusammenarbeit waren Rüstung und Transport. Nach der Niederlage im Krieg gegen Japan (1894/95) bedurften die chinesischen Streitkräfte dringend der Modernisierung. Deutschland konnte dazu beitragen, auch wenn den Deutschen zunächst nicht behagte, imperialistische Politik in Asien zu betreiben Die revolutionäre Stimmung in China trieb jedoch auf den Sturz des Kaiserreichs und die Machtergreifung durch Sun Yat-sen zu und begünstigte den Handel mit Rüstungsgütern und damit die deutsche Rüstungsindustrie. Deutsche Berater halfen dabei, die chinesische Armee effizienter zu machen; Krupp brachte die Festungsanlagen von Port Arthur auf den neusten Stand.
Unter Kaiser Wilhelm II. wurde ein Richtungswechsel hin zum Wirtschaftsexpansionismus vollzogen, der mit politischer und militärischer Expansion einherging. Während des sogenannten Boxeraufstandes des Jahres 1900 kam es zu direkten bewaffneten Zusammenstößen des deutschen Expeditionskorps mit der einheimischen Protestbewegung gegen die ausländische Präsenz im Lande. Das hinderte jedoch mehr als dreihundert Unternehmen verschiedener Branchen nicht daran, sich im ersten Jahrzehnt des neuen Jahrhunderts in China niederzulassen.
Die engen bilateralen Beziehungen mündeten nicht allein im regen Handelsaustausch, sondern auch in Reformen des chinesischen Rechtssystems. Das chinesische Bürgerliche Gesetzbuch nahm gewisse deutsche Rechtsvorschriften zum Vorbild, so auch im Bereich des Wirtschaftsrechts. Die Pekinger Reformer orientierten sich an westlichen Modellen. Nach vielversprechenden Anfängen kamen jedoch die Wirtschaftsbeziehungen nach Ausbruch des Ersten Weltkriegs praktisch zum Erliegen, so dass in China nur noch zwei deutsche Firmen tätig blieben.
Nationalsozialisten in China
Trotz der inneren Wirren in China verbesserten sich die Wirtschaftsbeziehungen mit der Zeit wieder. Der Bürgerkrieg nach dem Fall des Kaisertums und Sun Yat-sens Tod (1925) sorgte für die Entstehung eines Absatzmarktes für Rüstungsgüter. Im Widerspruch zum Versailler Vertrag schlossen deutsche Unternehmen Verträge mit ausländischen Partnern, um die vertraglichen Einschränkungen nach dem Weltkrieg zu umgehen. Diese Einschränkungen hinderten die Deutschen nicht daran, ihre Produkte nach China zu verkaufen. Während Deutschland offiziell kein militärisches und politisches Interesse an dem Land bekundete, baute es doch Beziehungen zu dem neuen chinesischen Regime auf, der Kuomintang.
Deutsche Berater und in Deutschland ausgebildete Chinesen unterstützten den Kuomintang-Führer Chiang Kai-shek dabei, das Land während des Bürgerkriegs zu stabilisieren. Chiang nahm diese Hilfe gern in Anspruch, zumal er ohnehin der Auffassung war, China solle sich politisch an Deutschland orientieren.
Das änderte sich auch nicht nach der Machtergreifung der NSDAP. Die Nazis sahen in China aus verschiedenen Gründen einen strategischen Partner, wovon Chinas ungeheuren Rohstoffvorkommen nur ein Grund war, die für Deutschlands Umstellung auf Kriegswirtschaft benötigt wurden. Ein anderer Grund war, sich von der zumindest nach außen vorsichtigen Außenpolitik der Weimarer Regierungen abzusetzen. Das in den dreißiger Jahren mit China geschlossene Abkommen zur Belebung des bilateralen Handels brachte den Deutschen Rohstofflieferungen und den Chinesen weitere Entwicklungsmöglichkeiten.
Dank dieser Zusammenarbeit konnten die Chinesen auch ihr Eisenbahnnetz ausbauen. Während der NS-Herrschaft war die deutsch-chinesische Partnerschaft zeitweise so eng, dass siebzehn Prozent des chinesischen Außenhandels mit Deutschland betrieben wurde. Die Zusammenarbeit erstreckte sich auf alle Gebiete vom Eisenbahnbau bis zur Rüstung.
So konnten sich die Chinesen trotz Niederlagen dank deutscher Gewehre und Mörser im Zweiten Chinesisch-Japanischen Krieg (1937–1945) behaupten. Diese Auseinandersetzung war für die chinesische Wirtschaft jedoch derart verheerend, dass Hitler trotz der lange währenden fruchtbaren Kooperation beschloss, den Handel von China nach Tokio zu verlagern. Obwohl beide Seiten versuchten, ihre Beziehungen aufrechtzuerhalten, schloss sich China im Zweiten Weltkrieg schließlich den Alliierten an.
Zwei Länder, zwei Systeme
Nachdem der Zweite Weltkrieg mit der Teilung Deutschlands und nach einem weiteren Bürgerkrieg der Machtergreifung der Kommunisten in China geendet hatte, gab es nach einer gewissen Zeit erneute Bemühungen, die Wechselbeziehungen auf politischem und wirtschaftlichen Gebiet wiederzubeleben. Nach dem Sieg der Kommunisten in Festlandchina flohen viele in Deutschland ausgebildete Spezialisten nach Taiwan. Es ist keine Übertreibung zu sagen, dass dieses in Deutschland ausgebildete Personal zum taiwanesischen Wirtschaftswunder beitrug.
Die Aufteilung der Welt in zwei Blöcke war zunächst einmal dem wirtschaftlichen Austausch nicht förderlich. Europa war geteilt wie Deutschland, die ideologischen Unterschiede und die geopolitischen Bündnisse sorgten dafür, dass vor allem die DDR diplomatische Beziehungen mit der Volksrepublik China aufbaute, während die Regierung in Bonn nicht sonderlich an einem engen Verhältnis zu den Pekinger Kommunisten interessiert war. Auch für Beziehungen mit Taiwan engagierte sich die Bundesrepublik nicht besonders, zumal mit Rücksicht darauf, dass damals sowohl Peking als auch Taipeh eine Politik des „einen China“ vertraten und dies mögliche Konsequenzen für die deutsche Wiedervereinigung haben konnte. Gerade in Sorge um die deutsche Wiedervereinigung hat die Bundesrepublik daher auch die Republik China (Taiwan) nie offiziell anerkannt.
Dennoch wurden noch vor Aufnahme diplomatischer Beziehungen Versuche gemacht, Wirtschaftskontakte herzustellen. 1957 wurde eine Wirtschaftspartnerschaft zwischen dem Chinesischen Rat für die Förderung von Handel und Investitionen und dem Deutschen Komitee für die Wirtschaftszusammenarbeit mit Osteuropa geschlossen.
Anfängliche Sondierungen der chinesischen Seite in den fünfziger Jahren blieben vor allem aufgrund der ideologischen Unvereinbarkeit und des Kräftepotentials ohne Ergebnis. Damals unterhielt die DDR überhaupt keine Kontakte mit Peking, und die Rolle eines Garanten einer eventuellen Wiedervereinigung sollte aus deutscher Sicht der UdSSR zufallen, die sowohl in Bonn als auch in Ostberlin Botschaften hatte. Die Versuche Chinas, mit Westdeutschland diplomatische Beziehungen aufzunehmen, galten daher als Propagandaunternehmung.
Der Umbruch erfolgte Mitte der sechziger Jahre, als Frankreich die Regierung in Peking anerkannte; im Anschluss daran führten Bonn und Peking inoffizielle Gespräche. Die Kulturrevolution brachte diese anfänglichen Kontakte zum Erliegen, doch blieb der Wunsch, sich einander anzunähern. Die Gelegenheit dazu sollte sich kurze Zeit später infolge der politischen Umbrüche in China und der Sowjetunion ergeben. Die Abkühlung der Beziehungen zwischen Moskau und Peking brachte einen Teil der bundesrepublikanischen Politik zu der Auffassung, man könne die Spannungen dazu nutzen, einen gegen Moskau gerichteten antikommunistischen Block aufzubauen. Der Regierungsantritt von Bundeskanzler Willy Brandt und die von ihm initiierte Ostpolitik, die auf die Verbesserung des Verhältnisses mit Polen, der DDR und selbstverständlich Moskau abzielte, machten alle Hoffnungen auf eine Verständigung mit Peking zunichte.
Erst Anfang der siebziger Jahre und nach Unterzeichnung der Ostverträge machte sich der junge SPD-Politiker Gerhard Schröder auf den Weg nach China, um sich mit Premier Zhou Enlai zu treffen. Beide Seiten loteten aus, welche Möglichkeiten bestünden, offizielle Beziehungen anzuknüpfen, und bereiteten damit weitere Besuche auf ministerieller Ebene vor, bei denen sich ein ziemlich überraschendes Vorkommnis ereignete.
Denn bei einer Begegnung von Bundesaußenminister Walter Scheel mit Zhou Enlai Ende 1972 anerkannte letzterer die Existenz einer einzigen deutschen Nation. Zwar bestanden aus Zhous Sicht zwei unterschiedliche deutsche Staaten, doch nur eine Nation. Bei weiteren Begegnungen kamen sich die Gesprächspartner aus Bonn und Peking näher, so dass auch jüngere Oppositionspolitiker wie etwa der spätere Bundeskanzler Helmut Kohl nach China eingeladen wurden und sich schließlich auch Bundeskanzler Helmut Schmidt und Vorsitzender Mao Zedong 1975 persönlich begegneten.
Dies stand am Anfang eines langen und schwierigen Weges zur Normalisierung der Beziehungen.
Die Reformer in der Offensive und die graue Zone
Der Wechsel an der Führungsspitze in China nach Maos Tod 1976 ließ neue Rahmenbedingungen aufkommen. Nachdem Deng Xiaoping Ende der siebziger Jahre die wechselhafte Lage in seinem Land unter Kontrolle gebracht hatte, war der Weg offen für eine langfristige, stabile Zusammenarbeit zwischen Westdeutschland und Peking. Als erste machten sich investitionswillige bayerische Unternehmen auf den Weg nach China. Dengs Wirtschaftsreformen, die auf rasche Entwicklung und Steigerung des chinesischen Lebensstandards gerichtet waren, brachten die erwarteten Erfolge.
Selbst die Ereignisse des Jahres 1989 konnten die rasch an Fahrt aufnehmende Kooperation nicht aufhalten. Das Massaker auf dem Tiananmen-Platz führte nur zu einer vorübergehenden Abkühlung in den wechselseitigen Beziehungen. Anfang der neunziger Jahre begann auf Initiative Helmut Kohls ein neues Kapitel in der deutschen Chinapolitik. Kohl, der wie gesagt bereits zuvor in China gewesen war, kreierte eine neue Asienpolitik. Er ermunterte deutsche Investoren, ihre Geschäftstätigkeit in China auszuweiten. Dem leisteten die Unternehmer Folge, Kohl dagegen willfahrte der Pekinger Linie und richtete sich nach dem Prinzip der Ein-China-Politik.
Die deutsche Diplomatie tanzt hierbei auf vielen Hochzeiten gleichzeitig. Einerseits erkennt sie Taiwan nicht als unabhängigen Staat an, unterhält mit dem Land aber gute kulturelle und wirtschaftliche Beziehungen, andererseits sind die Beziehungen zu Peking ungetrübt. Die Vernunftehe zwischen Berlin und Peking kennt eigentlich nur eine strikte Bedingung, nämlich die Nichtanerkennung Taiwans. Sollte sich gelegentlich ein Problem ergeben, wie etwa beim Eintritt Chinas in die Welthandelsorganisation (WHO) 2001, aufgrund dessen das Handelsabkommen von 1979 geändert werden musste, ist es schnell aus der Welt geschafft. Vierzig Jahre nach Unterzeichnung der ersten Dokumente über die Aufnahme diplomatischer Beziehungen blüht der deutsch-chinesische Handel. Das blieb auch so nach dem Fall der Berliner Mauer und dem Beginn des neuen Jahrhunderts.
Mit der Schließung weiterer bilateraler Abkommen zum Technologietransfer und zur Vermeidung von Doppelbesteuerung wurde darüber hinaus das deutsch-chinesische Verhältnis zu einer strategischen Partnerschaft ausgebaut. Dies vollbrachte 2004 gemeinsam mit Premier Wen Jiabao niemand anderes als Kanzler Gerhard Schröder, der sich schon vorher durch seine guten Chinakontakte hervorgetan hatte. Die Partnerschaft ist auf Jahrzehnte hin ausgelegt. Da die Deutschen nicht ganz aufgeben können, über Menschenrechte zu sprechen, richteten sie Anfang der neunziger Jahre eigens zu diesem Zweck einen Kooperationskanal mit den Chinesen ein. Schwierige Probleme werden bei bilateralen Treffen behandelt, davon unabhängig besteht aber eine enge Zusammenarbeit auf den Gebieten Forschung und Entwicklung, Expertenaustausch, Dienstleistungen und Technologietransfer.
Ein weiterer Meilenstein fiel bereits in die Amtszeit von Angela Merkel, die 2010 die Kontakte mit Peking noch enger gestaltete. Damals mündete ein Treffen in die Idee, regelmäßige Jahreskonsultationen auf höchster Ebene abzuhalten. Auch die Zusammenarbeit auf den Gebieten Klein‑ und Kleinstunternehmen sowie erneuerbare Energien wurde ausgeweitet.
Das wurde durch die Wirtschaftsentwicklung begünstigt. Die Krise der Eurozone zwang Berlin zu einer ökonomischen Neuorientierung. Dabei erschien China als natürlicher Partner. Die intensive Wirtschaftszusammenarbeit stieg in den Jahren 2008 bis 2014 auf ein Volumen von 74 Milliarden Euro beim deutschen Export nach China und 80 Milliarden in umgekehrter Richtung.
Erste Risse in der Zusammenarbeit zeigten sich 2015, als mit dem Regierungsumbau in Deutschland erstmals seit einem Jahrzehnt nicht mehr ein FDP-Politiker für die Wirtschaftspolitik verantwortlich war, sondern der Sozialdemokrat Sigmar Gabriel. Das fiel zeitlich zusammen mit einigen Problemen, die sich aus Chinas Beitritt zur WHO ergaben.
Mit dem Beitritt erklärte China sein Einverständnis, dass die Europäische Union im Bedarfsfall Zölle auf zu Dumpingpreisen angebotene chinesische Waren erheben würde. Die Anti-Dumping-Maßnahmen sollten zum Teil nach fünfzehn Jahren entfallen, weshalb China 2016 zu fordern begann, der Westen solle seine Wirtschaft als Marktwirtschaft anerkennen. Die Stahlkrise im selben Jahr, ausgelöst von der Überschwemmung des Marktes mit billigen Stahlerzeugnissen aus China und den dagegen gerichteten Arbeiterprotesten in Deutschland, führte dazu, dass es Deutschland nicht sonderlich daran gelegen ist, die chinesische Wirtschaft als Marktwirtschaft anzuerkennen. Die Krise veranlasste eine Intervention der Europäischen Kommission.
In den Folgejahren stellten sich weitere Probleme ein. Deutsche Unternehmen greifen gern auf China als billigen Produktionsstandort zurück. In China stehen deutsche Fabriken und in den letzten Jahren floss Kapital aus Berlin nach Peking – nicht jedoch in umgekehrte Richtung. Daher begann die deutsche Politik sich dafür zu interessieren, wie die Handelsbilanz wirklich aussieht; auch wurde ein genauerer Blick auf Fragen wie den Technologietransfer geworfen.
Dabei stellte sich beispielsweise heraus, dass chinesische Firmen entgegen den anfänglichen Plänen nicht ausschließlich in dringend auf Kapital angewiesene weniger bekannte Unternehmen investieren. Die kaufkräftigen chinesischen Investoren sahen sich auch nach Unternehmen mit besonders wertvoller Technologie um. Die Chinesen investierten in die Flugzeug‑ und Energiebranche. Aus deutscher Sicht trat ein Umbruch ein, als ein chinesischer Fonds beschloss, die Kuka AG aufzukaufen, einen führenden Roboterhersteller.
Die politischen Folgen der Firmenübernahme waren nicht so sehr problematisch im Hinblick auf die strategische Bedeutung des Unternehmens als vielmehr auf die Ohnmacht der Bundesregierung, die kein Gegenmittel gegen das chinesische Kapital wusste. Berlins verzweifelte Versuche, die Übernahme zu verhindern, gerieten zum Fiasko, weil die deutschen Unternehmen anerkannten, dass die von dem chinesischen Kaufinteressenten offerierte Summe von fünf Milliarden Euro nicht zu toppen war. Es fehlte an Kontrollinstrumenten, weshalb man sich an Brüssel zwecks Novellierung der Wettbewerbsvorschriften wandte. Die EU sollte in die Lage gebracht werden, kontrollieren zu können, wer von außerhalb der EU Unternehmen in den Mitgliedsländern übernimmt.
Zurzeit gestaltet sich die Situation ziemlich unübersichtlich – man bedenke das komplexe Beziehungsgeflecht in der Region, den Handelskrieg zwischen den USA und China sowie einen möglichen Konflikt zwischen Brüssel und Peking in Handels‑ und Menschenrechtsfragen. Deutschland befindet sich gegenwärtig auch deshalb in einer sehr schwierigen Lage, weil die deutsche Gesellschaft starken Druck auf eine weitere protektionistische Bewegung ausüben könnte, zumal deutsche Firmen häufig auch außerhalb der Landesgrenzen bei Investitionen überboten werden.
Ein weiteres Konfliktfeld ist die Vorratsdatenspeicherung. Die chinesische Regierung hat unlängst deutsche Unternehmen der Autobranche dazu verpflichtet, Daten aus Elektroautos den zuständigen Behörden zu überlassen. Dabei werden Befürchtungen ignoriert, die technische Sicherheit könne gefährdet, Technologie könne kopiert und die Privatsphäre von Fahrern verletzt werden.
Der von China betriebene konsequente Aufbau der Neuen Seidenstraße und die auf eine Renaissance der chinesischen Großmachtposition angelegte Politik Pekings sorgen dafür, dass sich möglicherweise noch weitere Konfliktfelder auftun werden. Zum einen das wirtschaftliche Ungleichgewicht in den Handelsbeziehungen mit einem chinesischen Handelsüberschuss von 18 Milliarden Euro im Austausch mit der Bundesrepublik, zum andern die immer stärkere politische Expansion könnten die liberale Demokratie in Deutschland gefährden. Das Problem besteht nicht allein darin, dass sich China international als Konkurrent des Westens positioniert, um eine multipolare Welt zu schaffen, sondern auch im hohen Staatsanteil am chinesischen Kapital. Eine Reaktion auf die Entwicklung der Handelsbeziehungen könnte sein, politische Schritte etwa in Gestalt von Unterstützung der chinesischen Dissidenten oder in der Tibetfrage zu unternehmen.
Eine Lösung muss beide Seiten berücksichtigen, damit die ökonomischen Probleme sich nicht zu sozialen Problemen auswachsen. Vielleicht sollte China offener für Unternehmen aus Europa und den Vereinigten Staaten werden. Das neue Jahrzehnt wird jedenfalls interessant zu verfolgen sein, weil China selbst mit zahlreichen Strukturproblemen zu tun hat, sei es die Bevölkerungsentwicklung oder auch die Veränderungen der chinesischen Mittelschicht.
Wir leben in spannenden Zeiten. Es ist im Interesse Deutschlands wie der ganzen EU, die Entwicklung in China weiter zu beobachten.
Aus dem Polnischen von Andreas R. Hofmann