Zum Jahresende 2020 ist es in den Beziehungen zwischen der Europäischen Union und China zu einer Wende gekommen. Nach siebenjährigen Verhandlungen haben Brüssel und Peking eine politische Einigung in Sachen Investitionsabkommen erzielt. Wer profitiert davon und wer verliert?
Seit 2013 haben die Europäische Union und China das Investitionsabkommen verhandelt. Es betrifft in erster Linie die Regulierung ausländischer Direktinvestitionen (FDI). Darüber hinaus hatten die Europäer gehofft, dass es ihre Forderungen nach leichterem Zugang europäischer Unternehmen zum chinesischen Markt berücksichtigen wird.
 Genau diese Frage stand dem Abschluss des Abkommens jahrelang im Wege. Peking betrachtete die Möglichkeit einer freien Konkurrenz auf seinem eigenen Markt mit Missfallen, es förderte seine Unternehmen großzügig mit staatlichen Subventionen, während westliche Firmen oft für die Zulassung zur Geschäftstätigkeit in China im Gegenzug zu Technologietransfers gezwungen wurden. Doch in der zweiten Jahreshälfte 2020 machte China gewisse Zugeständnisse zugunsten europäischer Unternehmen, die unter anderem die Branche für Elektroautos und das private Gesundheitswesen betreffen sollen. China hat sich auch zu bestimmten strukturellen Veränderungen verpflichtet, beispielweise im Bereich von Joint Ventures europäischer Unternehmen mit chinesischen Firmen. Nach Meinung der Europäischen Kommission soll die Konzession auch ein Versprechen sein, dass China sich bemühen wird, nach und nach von der Inanspruchnahme von Zwangsarbeit abzukommen.
Genau diese Frage stand dem Abschluss des Abkommens jahrelang im Wege. Peking betrachtete die Möglichkeit einer freien Konkurrenz auf seinem eigenen Markt mit Missfallen, es förderte seine Unternehmen großzügig mit staatlichen Subventionen, während westliche Firmen oft für die Zulassung zur Geschäftstätigkeit in China im Gegenzug zu Technologietransfers gezwungen wurden. Doch in der zweiten Jahreshälfte 2020 machte China gewisse Zugeständnisse zugunsten europäischer Unternehmen, die unter anderem die Branche für Elektroautos und das private Gesundheitswesen betreffen sollen. China hat sich auch zu bestimmten strukturellen Veränderungen verpflichtet, beispielweise im Bereich von Joint Ventures europäischer Unternehmen mit chinesischen Firmen. Nach Meinung der Europäischen Kommission soll die Konzession auch ein Versprechen sein, dass China sich bemühen wird, nach und nach von der Inanspruchnahme von Zwangsarbeit abzukommen.
Obwohl alle Seiten das Abkommen als Erfolg bezeichnen, bleibt sein Schicksal unsicher. Die Ratifizierung durch das Europäische Parlament soll in der ersten Jahreshälfte 2022 erfolgen, wenn – was nicht ohne Bedeutung ist – Frankreich die EU-Ratspräsidentschaft innehaben wird. Doch dem Abkommen in seiner aktuellen Form ist das Europäische Parlament nicht geneigt, und es hängt von seiner Entscheidung ab, ob das Abkommen in Kraft tritt. Unabhängig davon, ob es dazu kommt, sagt allein die Tatsache, dass es in den europäisch-chinesischen Beziehungen zu einer Beschleunigung gekommen ist, sehr viel über die Richtung aus, in die sich die Europäische Union mit Angela Merkel und Emmanuel Macron am Steuer bewegen will.
Macht sich die EU unabhängig?
Kritiker des Abkommens mit China machen der EU (vor allem gegenüber Deutschland und Frankreich) zahlreiche Vorwürfe. So wird ihr vorgeworfen, das Problem der Einhaltung der Menschenrechte in China zu ignorieren, aber auch mangelnde konkrete Zugeständnisse seitens Pekings und die sehr beschränkte Öffnung des chinesischen Marktes für europäische Unternehmen. Zu den Vorwürfen, die auch aus Polen kommen, gehört auch, dass Joe Bidens Regierung, die am 20. Januar die Macht übernommen hat und sich das Ziel gesetzt hat, die transatlantischen Beziehungen zu verbessern, zuvor nicht konsultiert wurde.
Zum Teil sind diese Vorwürfe berechtigt. So hat China etwa in Sachen Zwangsarbeit lediglich versprochen, dass es „dauerhafte Bemühungen“ für die Ratifizierung der entsprechenden Konventionen zur Einhaltung der Menschenrechte anstellen werde. Diese Formulierung kann zukünftig frei interpretiert werden, und derartige Versprechungen verpflichten China in Wirklichkeit zu rein gar nichts. Die größere Freiheit für europäische Firmen auf dem chinesischen Markt soll auch nur einige wenige Branchen betreffen, was laut Kritikern zeigt, dass man mit dem Abkommen warten und mit Peking viel mehr hätte aushandeln sollen. „Das ist ein Abkommen, das ich nicht akzeptieren kann“, schrieb der französische Europaabgeordnete Bernard Guetta, und verlieh damit der Einstellung vieler seiner Kollegen im Europäischen Parlament Ausdruck.
Trotzdem sprechen die Staatsoberhäupter Deutschlands und Frankreichs nicht grundlos von einem großen Erfolg. Obwohl Kanzlerin Angela Merkel sich als jemand zu geben pflegt, die Macrons Streben nach Souveränität und strategischer Autonomie Europas temperiert und glättet, lassen sich anhand des Abkommens mit China bezüglich der Position der deutschen Bundeskanzlerin mehr Nuancen ablesen.
Seit einigen Jahren, im Grunde seit dem Beginn der Amtszeit von Donald Trump, ist Merkel der Meinung, dass Europa sich auf sich selbst verlassen muss und nicht alle seine Aktiva in das Bündnis mit Amerika investieren darf. In dem Magazin Foreign Policy schreibt Noah Barkin, Merkel sei sich darüber im Klaren, dass im Jahr 2020 über 74 Millionen Amerikaner für Trump waren und sich das nicht von einem Tag auf den anderen ändern werde. Mehr noch, so Barkin, in Berlin bestehe die Überzeugung, dass es sich bei Trumps Präsidentschaft gar nicht um eine Anomalie gehandelt hat, nach welcher die transatlantischen Beziehungen wieder auf die alten Gleise zurückkommen. Deshalb will Merkel sicherheitshalber die Beziehungen mit möglichst vielen Partnern festigen – auch mit Großmächten, die Amerika nicht genehm sind. Und es war Merkel, die sogar stärker als Macron darauf drängte, die Verhandlungen mit China spätestens Ende 2020 abzuschließen. Dies sollte die neue amerikanische Regierung vor vollendete Tatsachen stellen und Europa in die Position eines gleichberechtigten Partners für die beiden stärksten Großmächte bringen.
Selbst wenn Merkels Politik weniger spektakulär ist als Macrons Politik und sich diese unter anderem in der Bewertung der globalen Rolle Amerikas unterscheidet, steuert sie im Endeffekt trotzdem in eine ähnliche Richtung. Diese Richtung führt zum Aufbau eines europäischen Pols in einer entstehenden multipolaren Welt. Manchmal – wie im Falle des Abkommens mit China – findet das auf Kosten besserer Bedingungen statt, die die EU hätte verhandeln können, wenn sie sich mehr Zeit gelassen hätte.
Aber die EU profitiert von dem Abkommen mit China nicht so viel, wie sie hätte können, vor allem deshalb, weil die ganze Situation ein Signal in Richtung USA sein soll. Kein Warnsignal, weil die EU in guten Beziehungen zu Amerika bleiben will, sondern eine Information. Diese Information an Washington besteht darin, dass die größten EU-Staaten die chinesisch-amerikanische Rivalität nicht als einen neuen Kalten Krieg wahrnehmen und die Möglichkeit haben wollen, auch Druck auf ihre Bündnispartner in Washington auszuüben. Dieser Druck kann Brüssel nützlich werden, wenn beispielsweise die Absicht, die amerikanischen Soldaten aus Europa abzuziehen, sich nicht als lediglich vorübergehende Laune Trumps erweisen sollte.
Wovon profitiert China?
Bevor wir uns ansehen, was aus alledem für Polen folgt, soll festgehalten werden, dass der größte Nutznießer des ausgehandelten Abkommens China ist.
Erstens hat Peking es ausgenutzt, dass Europa es eilig hat, unabhängig zu werden. Deutschland und Frankreich wollen, dass Europa zu einem der Pole der neuen multipolaren Ordnung wird, und China kommt das sehr entgegen. Warum? Weil ein System, in dem es mehr als zwei Global Player gibt, mehr Möglichkeiten bietet für den Umgang mit den eigenen Interessen und für deren Umsetzung, für Interaktionen mit unterschiedlichen Partnern und für die Suche nach gemeinsamen Interessen selbst mit ideologisch weit entfernten Staaten. In einer Welt, die sich die Amerikaner wünschen – sprich in einem neuen Kalten Krieg und einer bipolaren Polarisierung, wo China dem vereinten Westen unter der Führung der USA gegenübersteht –, hätte China kein solches Handlungsfeld und müsste, so wie einst die Sowjetunion, nach einzelnen Bündnispartnern suchen, hauptsächlich unter den Staaten der einstigen Dritten Welt.
Zweitens hat der zeitliche Zusammenhang des Abkommens zwischen China und der EU auf natürliche Weise neue Spannungen in der Brüssel-Washington-Linie geschaffen. Joe Bidens Regierung ist so sehr an korrekten transatlantischen Beziehungen interessiert, dass Bidens Berater wollten, dass Brüssel sich Zeit lässt mit dem Abkommen und es vor Abschluss mit den USA konsultiert. Doch trotz der wiederholten Bitten (unter anderem von Jake Sullivan, Bidens Berater in Sachen nationale Sicherheit) haben die Europäer sich nicht mit den Amerikanern besprochen und sich wie ein von ihnen vollkommen unabhängiges Subjekt verhalten. In der entstehenden multipolaren Welt ist das für China eine traumhafte Situation.
Eine Lektion für Amerika
Und deshalb ist es eine Lektion für Amerika. Obwohl die EU die neue US-Regierung vor eine unangenehme vollendete Tatsache stellt, müssten vor allem die Amerikaner daraus die richtigen Schlussfolgerungen ziehen und ihr Handeln an die existierende Situation anpassen.
Die Amerikaner müssen sich bewusstmachen, dass die heutige Welt bereits multipolar ist, und die Zeit, als die Weltpolitik ihren Launen ausgeliefert war, vorbei ist. Obwohl Trumps Regierung neue Gefahren für die Sicherheit der USA identifiziert hat, hat sie es nicht geschafft, eine langfristige Strategie als Lösung auszuarbeiten – weder bezüglich der Zusammenarbeit mit Bündnispartnern noch hinsichtlich der Rivalität mit geopolitischen Gegnern. Dabei brauchen die Amerikaner in einer multipolaren Welt eine solche Strategie ebenso wie in Zeiten des Kalten Krieges. Der ehemalige Botschafter der Vereinten Nationen von Singapur, Kishore Mahbubani, ist der Meinung, dass Amerika sich mit dem Gedanken auseinandersetzen muss, seine bisherige Position des mächtigsten Staates der Welt zu verlieren. Doch ist es dazu bereit? Welche Strategie wird es fahren? Die aktuelle Situation und das „Geschenk“ in Form des Abkommens zwischen EU und China zeigen, dass Amerika die Fragen, die Mahbubani stellt, mit der größten Ernsthaftigkeit behandeln sollte. Sonst wird es von ähnlichen Ereignissen noch öfter überrascht werden.
Die von Trumps Regierung geführte „negative“ Politik, die auf Widerwillen gegen alles, was chinesisch ist, eingestellt ist, ohne eigene Gegenangebote, hat den Amerikanern nichts gebracht. Mehr noch, sie hat die Europäer regelrecht zu intensiveren Kontakten mit China ermutigt. Sollte also Washington nicht darüber nachdenken, was es Europa anbieten kann im Gegenzug dafür, dass Berlin und Paris eine skeptischere Haltung China gegenüber einnehmen? Davon, ob ein solches Angebot entsteht und was es beinhaltet, wird die Zukunft der transatlantischen Beziehungen abhängen, aber auch die Zukunft der Europäischen Union, die zerrissen ist zwischen Befürwortern eines schärferen Kurses China gegenüber und denen, die mit gefräßigem Blick auf die von dort fließenden Investitionen schauen.
Polen ist (bisher) auf der amerikanischen Seite
Bei diesem innereuropäischen Ringen hat sich Polen bisher recht deutlich für ein Bündnis mit den USA ausgesprochen und ist – trotz anfänglichen Interesses – der Entwicklung einer Zusammenarbeit mit Peking auf einem Niveau, wie es beispielsweise Ungarn anstrebt, abgeneigt. Warschau war dagegen, die Verhandlungen zum Abkommen zu beschleunigen, und betrieb Lobbyarbeit für deren Verlängerung und die Konsultation mit dem amerikanischen Bündnispartner. Damit stellte es sich den wichtigsten europäischen Partnern entgegen, die sich im chinesisch-amerikanischen Konflikt weiterhin nicht definitiv für eine Seite aussprechen wollen.
Unter den heutigen politischen Gegebenheiten stimmen Polens Pläne mit den bipolaren Vorstellungen der Amerikaner überein. Wird das in voraussehbarer Zukunft so bleiben? Und lässt sich eine solche Politik in einer Zeit aufrechterhalten, in der die Amerikaner immer weniger willig sind, sich in Europa zu engagieren? Bis zu welchem Grad ist diese Politik für Polen selbst nützlich? Liegen Polens Interessen – aufgrund der geografischen Lage und wirtschaftlichen Gegebenheiten – nicht vor allem in Europa?
Die chinesisch-amerikanische Rivalität wird sich immer stärker auch auf Entscheidungen der größten EU-Staaten auswirken. Deshalb ist das Abkommen zwischen Peking und Brüssel keine vorübergehende Laune von Merkel und Macron, sondern ein bewusster Schritt auf dem Weg zu einer neuen internationalen Ordnung, auch wenn er vielleicht etwas schnell erfolgte. In den kommenden Jahren wird es weitere solche Schritte geben. Sind die Politiker in Warschau darauf vorbereitet?
Aus dem Polnischen von Antje Ritter-Miller



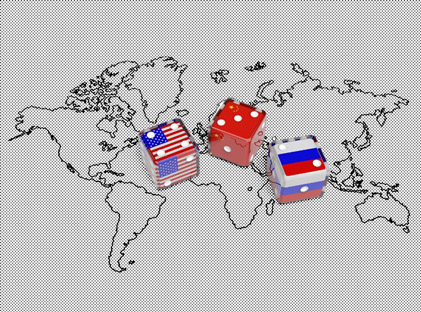




Pingback: Ein subjektiver Blick auf Deutschland | DIALOG FORUM | Themen aus Deutschland und Polen