Im demokratischen Teil der Welt wird Außenpolitik seit einiger Zeit nach dem sogenannten relationalen Paradigma betrieben. Ähnlich wie in anderen Bereichen von Gesellschaft und Öffentlichkeit, geht es dabei um die Herstellung von Verbindungen bzw. Relationen zwischen gleichberechtigten Subjekten, gleichviel ob es sich dabei um staatliche oder nichtstaatliche Akteure handelt. Daher kommt Qualitäten wie Vertrauen und sozialem Kapital in diesem Zusammenhang so große Bedeutung zu. Beides zu erhöhen, beabsichtigt das gegenwärtig weithin propagierte Modell der öffentlichen Diplomatie, das die Außenministerien immer konsequenter umzusetzen versuchen, wobei sie sogenannte weiche Faktoren wie Kommunikation, Kultur, Geschichte und Tradition betonen und im zwischenstaatlichen Verhältnis das Verbindende besonders herausstellen, während sie das Trennende herunterzuspielen trachten.
Dieselben Zwecke sollen der modernen Diplomatie die Richtung weisen, wie auch allen ihren Unterstützungseinrichtungen wie Thinktanks, Analysezentren, akademischen Institutionen, staatlichen Organisationen und privaten Stiftungen. Es ist unschwer zu erkennen, dass unter dem Einfluss des relationalen Paradigmas die bisherigen hierarchischen, nicht repräsentativen Handlungsmodelle von öffentlichen Organen an Bedeutung verlieren; diese bilden mittlerweise geradezu einen Anachronismus in Bezug auf eine sich dynamisch verändernde Wirklichkeit. Anders gesagt, Relationalität bedeutet auch mehr Demokratie, also mehr Rücksicht auf unterschiedliche, aber gleichberechtigte Subjekte. Zu denen selbstverständlich auch die Frauen gehören.
Soweit die Theorie, jetzt zur Praxis. Über diese Praxis reden wir nämlich selten. Denn was auch immer sonst gesagt wird, für die Diplomatie gilt: Schweigen ist Gold, und Schweigen über schwierige Themen ist schon eher Platin; aber das Problem ist wichtig und muss zur Sprache gebracht werden. Die Frage ist, wo sich innerhalb dieses neuen außenpolitischen Paradigmas die Frauen wiederfinden. Wenn wir uns einmal genauer anschauen, wie es zurzeit umgesetzt wird, haben wir es dann wirklich mit multidimensionaler Relationalität zu tun und damit auch mit Gleichheit aller Beteiligten? Und zwar nicht nur der Institutionen, sondern auch der Individuen, also auch der Männer und Frauen?

Diese Frage treibt mich schon längere Zeit um, besonders dringlich stellt sie sich aber bei sogenannten Fachkonferenzen zu den internationalen Beziehungen, auf denen Unterrepräsentation von Frauen und absolute Männerdominanz notorisch sind. Diese geradezu realsatirischen Zusammenkünfte, über die ich bereits in der Zeitschrift „Zadra“ (Splitter) in einem Text über Männerkliquen schrieb, sind fraglos eine Plage unserer Zeit. Davon zeugen etwa die polnische Facebookgruppe „Ich gehe nicht zu Panels, die nur von Männern bestritten werden“ („Nie chodzę na panele, w których występują tylko mężczyźni“) oder die am 8. März 2017 in der renommierten amerikanischen Zeitschrift „Foreign Policy“ veröffentlichen sieben Regeln, wie ausschließlich männliche Panels vermieden werden können („How to Avoid All-Men Panels“), verfasst von der angesehenen Politologin Jacqueline O’Neill. Auch die von Männern beherrschten Aufsichtskörperschaften, Programmräte und ehrwürdigen Beratungsgremien aller Art geben Anlass zu Verstimmung. In Polen sind sie leider der Normalfall.
Mit der Suche nach der tatsächlichen Implementierung des relationalen Paradigmas gehe ich der Frage nach, wieso es zu diesen exklusiv männlichen Panels und Konferenzen unter Ausschluss von Frauen kommt. Mich treibt auch die in der Außenpolitik ebenso wie in der Politikwissenschaft und ‑beratung sichtbare ungleiche Rollenverteilung zwischen Frauen und Männern um, was Leitungs‑ und Führungspositionen betrifft. In meinen Untersuchungen gehe ich über die reine Beobachtung hinaus und erfrage immer wieder die Meinungen von Frauen, die an der Konzipierung von Außenpolitik beteiligt sind. Meine Gesprächspartnerinnen arbeiten in den drei europäischen Hauptstädten Warschau, Berlin und Kiew. Ich spreche mit ihnen an ihren Arbeitsplätzen, wir treffen uns aber auch in Cafés und auf Konferenzen. Mich interessiert, wie sie ihre Position innerhalb des diplomatischen Dienstes im weitesten Sinne verstehen und wie sie diese Berufssphäre interpretieren. Ob diese eine traditionelle Männerdomäne und Relationalität immer noch ein Desiderat ist oder ob die Forderung nach Gleichberechtung in diesem Bereich tatsächlich umgesetzt wird.
Ich beginne meine Untersuchungen in Warschau. Dort spreche ich hauptsächlich mit Politikberaterinnen, aber ich führe auch Gespräche mit Journalistinnen und Mitarbeiterinnen staatlicher Institute. Sie vertreten meist ähnliche Auffassungen und unterscheiden sich lediglich in Nuancen. Wenn ich nach der Situation von Frauen frage, sind sie nicht gerade begeistert. „Sehr oft bemerke ich, wie wenig Koleginnen bei den Besprechungen sind,“ sagt mir eine Expertin für deutsch-polnische Beziehungen, die in einer führenden Warschauer Denkfabrik arbeitet. „Metaphorisch gesagt, gibt es nur Krawatten und Anzüge und nur sehr wenige Frauen. Das ist nur ein ganz geringer Prozentsatz.“ „Woher kommt das?“ frage ich. Die Antwort lautet, dies sei eine Frage der Kultur und das wird später von fast jeder Interviewpartnerin bestätigt. Die polnischen Frauen seien demnach sehr kompromissbereit. Sie würden sich nicht gern in den Vordergrund stellen. Sie ergriffen das Wort nur dann, wenn sie wirklich etwas zu sagen hätten. Und auch dann müssten sie sich ihrer Sache ganz sicher sein. Das mache sich besonders im Bereich politischer Entscheidungsfindungen und Verhältnissen bemerkbar. Die Männer seien da ganz anders, meint dieselbe Gesprächspartnerin. „Vielleicht bin ich hier nicht sehr höflich gegenüber den Kollegen, aber mein Eindruck ist, dass sie sehr häufig etwas sagen, nur um sich sprechen zu hören. Um sich selbst darzustellen. Dies ist eine Eigentümlichkeit beim Thema Außenpolitik, bei dem sehr oft viel jüngere Männer, oft gleich nach dem Studium, von ihrem eigenen Wissen so überzeugt sind und sich produzieren wollen, so dass sie sich in den Vordergrund spielen und viel ältere und erfahrenere Kolleginnen an den Rand drängen, die vielleicht Interessantes zu sagen hätten.“
Ich habe vergeblich nach jemandem gesucht, der dazu eine andere Meinung gehabt hätte. Eine Frau, die Außenpolitik an der Hochschule lehrt, wo, wie ich oft zu hören bekam, die Situation schon viel besser sei als in der sogenannten Fachwelt, sagte es am deutlichsten: „Wir sind nicht da, und damit hat sich’s. Und wenn wir schon da sind, ist es so, als gäbe es uns gar nicht.“
Von dieser Äußerung frappiert, frage ich meine nächste Gesprächspartnerin, eine Mitarbeiterin am Polnischen Institut für Internationale Angelegenheiten. Die junge Frau, die in einer Diplomatenfamilie aufwuchs und Außenpolitik quasi mit der Muttermilch eingeflößt bekam, sagt mir auf den Kopf zu: „Die Männer haben es tatsächlich besser. Wir arbeiten in einer Welt, in der alles ausschließlich auf die Männer zugeschnitten ist. Das ist die sogenannte große Welt. Sie ist gleichsam eine Arkansphäre, zu der nur ganz wenige Zugang haben.“ Im Rückblick auf ihre eigenen Erfahrungen meint sie: „Es ist schließlich von Bedeutung, dass die längste Zeit ausschließlich Männer Diplomaten waren. Das bedeutete, der Mann wurde ins Ausland delegiert. Ein Man war Botschafter, Botschafts‑ oder Gesandschaftssekretär. Die Ehefrau konnte bestenfalls mitreisen, vielleicht im Range einer Botschaftergehilfin oder sie konnte im Sekretariat arbeiten.“
Es hatte aber den Anschein, diese Zeiten lägen hinter uns. Im polnischen diplomatischen Dienst fehlt es nicht an Botschafterinnen, auch nicht an strategischen Orten wie beispielsweise Moskau, wo Katarzyna Pełczyńska-Nałęcz Botschafterin ist. Meine Gesprächspartnerin stimmt mir zu, dass der Trend, den sie vorher beschrieben hat, sich im gleichen Verhältnis ändere, wie sich im 20. Jahrhundert die Welt geändert habe. Dennoch seien die internationalen Beziehungen noch immer eine reine Männerdomäne. Wie könnte man dem widersprechen, gab es doch, wie sie hinzufügt, in der polnischen Geschichte bislang nur eine einzige Außenministerin. „Das will doch sicher etwas heißen“, fügt sie pointiert hinzu.
Es heißt aber auch etwas, dass im Bereich der Außenpolitik tätige Frauen miteinander nicht solidarisch sind. Es gibt keine Initiativen, die in diesem Feld Beschäftigten zusammenzubringen, erst recht nicht die weiblichen Beschäftigten. Während im Unternehmensbereich solche Berufsvereinigungen existieren und es auch Zusammenschlüsse von Politikerinnen gibt, sind die Politikexpertinnen auf sich allein angewiesen. „Das ist geradezu eine Wüste,“ bekomme ich zu hören, wenn ich nach Zusammenschlüssen von Frauen in der Außenpolitik frage. Es gibt keinen Verein, es gibt keine informelle Gruppe auf Facebook, es gibt keine Zusammenkünfte, gemeinsamen Frühstücke oder Gesprächstreffen. Die schlimme Folge dieses Mangels an Initiative sind fehlende Kontakte (dabei reden wir hier doch von Relationalität, nicht wahr?), daher auch eine geringere Repräsentanz bei den Panels (wenn wir uns nicht kennen, laden wir einander auch nicht ein und unterstützen uns nicht gegenseitig) und weniger Engagement auf Führungsebene. Nach dem Motto „wer sich unauffällig macht, kommt weiter“, überlassen die Polinnen in der Außenpolitik das Steuer ihren männlichen Kollegen und engagieren sich kaum in Initiativen, die ihnen irgendwie helfen könnten, den ungünstigen Status quo zu ändern. Ihre Verbindungen sind zwar oftmals herzlich, aber einstweilen zu schwach, um eine starke Lobby für Frauen in der Außenpolitik oder Politikberatung zu bilden.
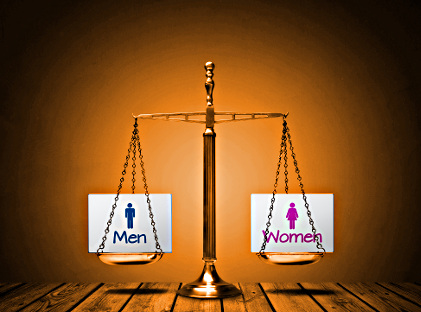
Weil ich die Lage von solchen Frauen in drei Staaten miteinander vergleichen wollte, war meine nächste Station für die Materialerhebung Kiew. Bei der Vorbereitung auf die Exkursion in die ukrainische Hauptstadt interessierte mich besonders, welche politische Rolle die Frauen nach dem Euromajdan spielen. Hat diese jüngste Revolution, allgemein bekannt als „Revolution der Würde“, tatsächlich zu einer Veränderung geführt und zu größerem Engagement von Frauen auf allen Ebenen des gesellschaftspolitischen Umbaus? Für meine Untersuchungen bildet die Ukraine offenbar einen Sonderfall. Die die Öffnung nach Europa befürwortende ukrainische Gesellschaft versucht, hauptsächlich dank des beständigen Engagements einer Vielzahl von Freiwilligen und oft immer noch gegen den Willen der Machthaber, breit angelegte politische Veränderungen zu realisieren, wie sie allgemein als Voraussetzungen für ein demokratisches System gelten.
In Kiew spreche ich mit jungen Frauen, die in den drei wichtigsten ukrainischen außenpolitischen Thinktanks arbeiten. Darunter ist Aljona Getmantschuk, der „Star der ukrainischen Außenpolitik“, wie mich Bekannte noch vor der Abfahrt instruieren. Tatsächlich ist dies keine Übertreibung für die einzige Ukrainerin, der es gelang, ein Interview mit dem US-Präsidenten zu bekommen, wovon nicht nur eine schön gerahmte Aufnahme aus dem Weißen Haus auf dem Regal in ihrem Büro zeugt, sondern was auch Aljona selbst nicht zu erwähnen versäumt. Sie erzählt ebenso von den Anfängen ihrer Einrichtung, die sie gründete, als sie als Journalistin in Kiew an die gläserne Decke gestoßen war. Doch lenke ich meine Gesprächspartnerin weg von ihrer persönlichen Karriere auf die Lager der Frauen in der Ukraine insgesamt und bemühe mich, mit ihrer Hilfe Umfang und Relevanz der Änderungen zu verstehen, welche die jüngste ukrainische Revolution auch für die Frauen in der Außenpolitik gebracht hat. Aljona, die bereits seit über zwanzig Jahren die Außenpolitik ihres Landes mitgestaltet, weist tatsächlich auf gewisse Veränderungen in Institutionen und Denkweisen hin; darunter ein Gesetz vom Juli 2015, das eine 30-Prozent-Quote in politischen Parteien vorschreibt. Bemerkenswert ist in diesem Zusammenhang auch die erste Frau, Olena Serkal, als stellvertretende Außenministerin der Ukraine. Alle meine ukrainischen Gesprächspartnerinnen äußerten sich enthusiastisch über diese Ernennung.
Aus meinen Gesprächen ist jedoch zu schließen, dass sich die Lage der Frauen in Kiew erheblich von unseren polnischen Erfahrungen unterscheidet. Viele ukrainische Politikexpertinnen bekennen nämlich, dass die Ukraine nach dem Euromajdan ein Ort für alle ist, ungeachtet des Geschlechts. Das politische Engagement sei weiterhin sehr stark und wer eine Idee habe und entschlossen genug sei, finde offene Türen vor. Natürlich gehen meine Gesprächspartnerinnen auch auf Fragen der Kultur ein; sie erinnern an das sowjetische Modell von Diplomatie und dessen bis heute überdauernde Residuen. Im Gegensatz zu den Fachfrauen in Polen und in Berlin formulierten die Ukrainerinnen Sätze wie: „Ich habe nie mitbekommen, dass mir als Frau bei dieser Arbeit etwas im Wege stand. Ganz im Gegenteil. Manchmal hat es mir geholfen. Besonders bei Verhandlungen.“ Oder: „Ich habe keine Diskriminierung erfahren. Es ist wahr, ich bin bei der Arbeit von lauter Männern umgeben; sie sind absolut in der Überzahl, aber ich merke wirklich nicht, dass ich irgendwie diskriminiert würde.“ Und sogar: „Frauen sind einfach weniger ehrgeizig, und sie glauben nicht an sich selbst.“
Nicht alle meine Gesprächspartnerinnen griffen zu solchen Formulierungen, doch fraglos weisen diese auf ein bestimmtes Paradox hin: Auch wenn die Demokratisierung der Ukraine das Prinzip der Gleichberechtigung mit einschließt, so gibt es bei ihren Akteuren offenkundig immer noch Widerstände dagegen, diese im westlichen Sinne zu begreifen, also auch sich solche Kategorien anzueignen, die negative Phänomene wie beispielsweise Genderdiskriminierung ins Bewusstsein heben könnten. Diese Eigentümlichkeit führt dazu, dass meine Gesprächspartnerinnen gleichsam vermeiden, die Genderdiskriminierung beim Namen zu nennen und dass sie dabei durchaus offen bekennen, Kinder können ein starkes Hindernis beim beruflichen Fortkommen sein; denn wenn auch vereinzelt Männer Elternurlaub nähmen, so bleibe das doch meist den Frauen überlassen. Die Unterstützung für junge ukrainische Mütter sei also gegenwärtig noch unzulänglich.
Meine nächste Station ist Berlin. Die Hauptstadt eines Landes, das mit harter Hand von einer Frau regiert wird, die, wie ich von vielen höre, in einer für sie sehr charakteristischen Art die Frage der Gleichberechtigung behandelt; indem sie nicht viel darüber spricht, aber ihre eigene Position durch Taten ausbaut. Diese Pastorentochter, die bei fast allen meinen Gesprächspartnerinnen starken Zuspruch findet, spielt derzeit sicher eine zentrale Rolle für das zukünftige Europa, scheint aber eher nicht als starke Protagonistin der Frauenrechte in die deutsche Geschichte einzugehen. Frauen wie die deutschen Politikexpertinnen gibt es in Deutschland viele und ihre Position ist dankenswerterweise eine andere als die ihrer polnischen oder ukrainischen Kolleginnen. Nicht ohne Grund fallen in meinen Berliner Gesprächen immer wieder Namen wie Rita Süssmuth, Marieluise Beck oder Constanze Stelzenmüller.
Aus meinen Berliner Gespräche geht für mich eindeutig hervor, dass die Frauen in Deutschland zwei Probleme bewältigt haben, an denen die Polinnen und die Ukrainerinnen noch arbeiten müssen. Es geht dabei um die gegenseitige Unterstützung durch Netzwerke von Frauen in der Außenpolitik und einen stärker gleichberechtigten Umgang mit dem Erziehungsurlaub. Auch wenn in Bezug auf diesen noch nicht alles ideal ist (viele Gesprächspartnerinnen erwähnen, dass die Lage in Frankreich und den skandinavischen Ländern besser sei) und, wie es eine Politikwissenschaftlerin aus einer internationalen Denkfabrik in Berlin sagte, „viele Frauen spüren immer noch, dass sie sich zwischen Arbeit und Familie entscheiden müssen“, so vollziehen sich doch Veränderungen, und jedes Jahrzehnt bringt eine Verbesserung, wie diejenigen Politologinnen mit der längsten Berufserfahrung feststellen.
So wie die Vereinbarkeit von Beruf und Privatleben besser gelöst zu sein scheint, sind auch die leidigen ausschließlich männlichen Panels nicht so allgemein üblich. Zwar kommen diese auch in Deutschland vor, doch in einem wesentlich geringeren Umfang als in Polen oder der Ukraine. Auch hierzulande geben Männer nicht so leicht ihre privilegierte Position in der Außenpolitik auf, doch ist es unvergleichlich leichter, mit ihnen über die Gleichberechtigung von Frauen und Männern zu sprechen als in den anderen beiden Hauptstädten.
Der Aufenthalt in den drei Städten und die Gespräche mit den Politikexpertinnen, die in Praxis und Theorie neue Ansätze in internationalen Beziehungen entwickeln, war für mich der schwierige Versuch zu begreifen, wie das Konzipieren von Außenpolitik und die diese bestimmenden Kräfte wirklich funktionieren. Ich versuchte dahinterzukommen, wieso, trotz lautstarker Befürwortung der Gleichberechtung, Frauen weiterhin eine zweitrangige Rolle spielen und ob die Männerdominanz in diesem Bereich doch nicht ganz überschätzt ist. Meine im Verlauf dieser Erhebung gesammelten Erfahrungen veranlassen mich zu vorsichtigem Optimismus. Veränderung und Fortschritt sind möglich und finden in allen drei Ländern statt. Leider schreiten sie sehr ungleich voran und werden vielfach von innen blockiert. Das erklärte Paradigma der Relationalität ist vielleicht keine Utopie, doch führt an bestimmten Orten noch ein weiter Weg dahin, denn in Wirklichkeit gilt tatsächlich: „Wir sind da, doch gibt es uns nicht“.
Die Gespräche für diesen Text wurden in Warschau, Berlin und Kiew mit finanzieller Unterstützung der Stiftung für Deutsch-Polnische Zusammenarbeit geführt.
Aus dem Polnischen von Andreas R. Hofmann








