Augsburg
Augsburg, nach München und Nürnberg die größte Stadt Bayerns, ist das wichtigste historische Zentrum des Landes Schwaben, dessen Gebiet sich zu einem großen Teil in den heutigen Grenzen Baden-Württembergs, des benachbarten Bundeslandes mit der Hauptstadt Stuttgart, befindet. In seinen Gebieten bedienen sich angeblich heute noch etwa 800.000 Menschen der schwäbischen Sprache, die vom Standarddeutschen noch weiter entfernt ist als das Bayerische.


Man kann sich kaum einen besseren Ort für die Autoreparatur vorstellen als Süddeutschland, wo wohl jedes Kleinkind zuerst lernt, einen Reifen zu wechseln, und erst später zu sprechen; dann aber, wie ich vermute, über die Motorisierung. So schien mir die Panne, die mich für etwas länger als ich geplant hatte in Augsburg festhielt, sogleich eine Fügung des Schicksals zu sein.
Augsburg wurde im Jahre 15 v. Chr. von den Römern als Heereslager gegründet, ähnlich wie Wien unter Marc Aurel. Den ersten Einwohnern war es unter dem Namen Augusta Vindelicorum bekannt, obgleich man wohl schnell den Namen in Augusta zu verkürzen begann. Der erste Teil jenes Namens war eine offenkundige Verneigung vor Kaiser Oktavian, den damaligen Herren von Rom und dieses Teils der Welt. Der zweite dagegen verriet, welchen keltischen Stamm damals zum Ruhm ihres Kaisers und Stiefvaters die Brüder Drusus und Tiberius besiegt hatten.
Die Vindeliker waren nicht die einzigen, die in jenem hier sicherlich denkwürdigen Jahr von den Römern geschlagen und unterworfen wurden. Ihr Los teilten andere Alpenvölker, unter ihnen die Räter, die der ganzen Provinz mit der Hauptstadt eben in Augusta den Namen gaben: Raetia. Ihre Nachkommen sollen die heutigen Rätoromanen sein, eine ethnische Minderheit, die vor allem das italienisch-schweizerische Grenzgebiet bewohnen und die rätoromanische Sprache, eine der vier Amtssprachen der Schweiz, verwenden. Angeblich haben die Räter (die nach der einheitlichen Überzeugung der Altertumshistoriker von den Etruskern abstammten) anders als Germanen oder Kelten nicht besonders gegen die römische Herrschaft rebelliert, deshalb erfreute sich diese, in geringem Maße urbanisierte Region über längere Zeit des Rufs einer ländlichen Idylle.
Die Einwohner Augustas blicken auf ihre Frühgeschichte, obwohl sie durch eine Eroberung gekennzeichnet ist, voller Nostalgie, denn bis heute kann man an einem zentralen Punkt der Stadt die imponierende und gewissenhaft restaurierte Statue des Oktavian-Augustus bewundern, des Vaters auch dieses Vaterlands.
Herausragender Held der neueren Geschichte Augsburgs ist aber Jakob Fugger, der „reichste Mann aller Zeiten“, ein Unternehmer und Bankier, der in keinem geringeren Maße als seine Zeitgenossen Christoph Kolumbus und Leonardo da Vinci die Welt veränderte. Der Mann, der uns von dem berühmten Porträt Albrecht Dürers anblickt, revolutionierte Handel und Gewerbe, er veränderte die Weise, über Geld und den Umgang mit ihm zu denken. Bekannt war er als Bankier der Habsburger und als der wichtigste Akteur bei der Wahl der Kaiser. Aber nicht deshalb lieben ihn die Bewohner Augsburgs, sondern für seine visionäre und beispiellose Freigebigkeit.
1514 kaufte Jakob Fugger einen Teil der Stadt und begann dort mit dem Bau eines Sozialviertels, der ersten Initiative dieser Art in der Geschichte. Bis 1523 entstand dort eine Siedlung im Stil der deutschen Renaissance, in der die ärmsten und bedürftigsten Einwohner Augsburgs leben konnten. Das Viertel hat, obwohl es heute teilweise auch als Freilichtmuseum dient, seinen Charakter überhaupt nicht verloren. Man kann nach wie vor dort bis zum Tod leben, wenn man eine symbolische Miete in Höhe von 0,88 Euro zahlt. Aber nicht jeder kann Bewohner der Fuggerei werden. Es gibt außer der finanziellen Lage zwei Bedingungen. Der Kandidat muss Bürger Augsburgs und katholisch sein. Wenn er dann schon in die Gemeinschaft aufgenommen wurde, ist er verpflichtet, dreimal täglich für den Stifter der Stätte, Jakob Fugger, zu beten.
Die Fuggerei, die seinerzeit z.B. Franz Mozart, den Urgroßvater des Komponisten, beherbergte, war über lange Jahrhunderte eine Idylle. Das Leben floss hier noch im Jahre 1943 ungetrübt, als Europa und die Welt schon an vielen Fronten Kriegshandlungen erschütterten. Aber nichts dauert ewig. Am 20. Februar begannen die Alliierten ihre Flugzeugoffensive gegen deutsche strategische Objekte in Augsburg. Am 25. Februar begannen Bomben auf die Messerschmitt-Werke zu fallen. In derselben Nacht und am nächsten Morgen führte man noch zwei weitere verheerende Luftangriffe auf die Stadt durch. Ähnlich wie in München – schrieb Stempowski – hat von den Bomben am meisten die Stadtmitte gelitten. Beinahe alle alten Häuser liegen in Trümmern. Die neuen Viertel, besonders die der Arbeiter, stehen unberührt. Dieses Bild ist kein Werk des Zufalls, denn die Bomben warf man präzise: inmitten der sie umgebenden Ruinen stehen die Kirchen unversehrt (28. November).
Man kann eine Zeitreise in jenes Augsburg machen, wenn man Schritt für Schritt in den engen Bunker hinabsteigt, der in der Fuggerei in der Sorge um seine Bewohner entstanden war. Heute, nach beinahe einem dreiviertel Jahrhundert, das uns von diesen Ereignissen trennt, können wir trotz der Geräusche alliierter Bomber, die sich aus den Lautsprechern vernehmen lassen, ohne Furcht dorthin zurückkehren und alte Fotos studieren, auf denen das rauchende und in den Staub sinkende Augsburg gezeigt wird.
Heute, im 21. Jahrhundert, wo die Welt sich derart beschleunigt hat und alles leicht verdaulich sein muss, könnte der Geschichtsunterricht über das, was das Jahrhundert der Krieg war, wenn es sein muss, auf einen Besuch in diesem Bunker und die Lektüre von Hemingways Erzählung Der alte Mann und das Meer begrenzt werden. Alles darüber hinaus, könnte sich einem erweiterten Programm „für Interessierte“ finden.
Was Stempowski nicht wissen konnte, der nur durch das Augsburg in Ruinen fuhr und hier weder Kontakte noch ein spezielles Ziel hatte, war, dass die Stiftung der Fugger-Familie schon im März 1944 gemeinsam mit den Stadtbehörden die Entscheidung über den Wiederaufbau traf. So trugen viele der Ruinen, die der Reisende wider Willen bedrückt betrachtete, bereits den Keim der Wiedergeburt in sich.
Das Augsburg von heute macht den Eindruck einer sehr heiteren, freundlichen und offenen Stadt. Obwohl die Zahl seiner Einwohner 300.000 nicht übersteigt, kann man sich des Eindrucks nicht erwehren, dass sie in einem dynamischen und modernen akademischen Zentrum leben, das an die Atmosphäre Krakaus oder Bolognas erinnert. Gleichzeitig ist es bei seiner ganzen Gemütlichkeit, sehr deutsch, westlich, also kulturell heterogen. Das arabische Restaurant liegt hier neben einem Kino. der Friseur „Habibi“ neben einem Gemüsehändler und die großartig erhaltene Synagoge neben einer Kirche, in der das Bild der Maria Knotenlöserin den heutigen Papst Franziskus dazu anregte, eine Politik der Öffnung zu betreiben.
Frankfurt am Main
Auch hier ist das Stadtzentrum völlig zerstört, schrieb Stempowski, seine ersten Eindrücke vom Nachkriegsfrankfurt registrierend. – Abends ist das ganze Viertel dunkel. Ich gehe in das Labyrinth der Ruinen und mache meine Taschenlampe an. Aus dem Dunkeln tauchen einige Gestalten auf, die auf den glücklichen Lampenbesitzer gewartet haben, um mit ihm auf das andere Mainufer zu gelangen. Der Boden ist uneben, voller Löcher und Steine. Viele stolpern und schneiden sich die Hand an Ziegeln und durcheinandergeratenen Schrott (29. November). Auch ich kam im Dunkeln nach Frankfurt, aber die Stadt, die ich im Jahre 2018 sehe, ist ein Labyrinth nicht von Ruinen, sondern von breiten Straßen, großen Brücken und ultramodernen Hochhäusern, die sich auf beiden Seiten des Mains auftürmen, dicht zusammengeballt, wie es sich für ein Weltfinanzzentrum gehört.
Am 18. und am 22. März 1944 führten die Kräfte der British Royal Air Force Luftangriffe auf Frankfurt durch, bei denen ungefähr 1.500 Personen umkamen. Von den etwa 2.000 Fachwerkhäusern überstand nur ein einziges die Bombardierungen komplett. Zerstört wurden fast alle Kirchen der Stadt. Eine Ausnahme war der Dom, der nur im symbolischen Maße litt. Nicht viele Bilder von Kriegszerstörungen kann man mit dem Panorama Frankfurts von 1944 vergleichen, bei dem das wichtigste Gotteshaus der Stadt unangetastet in einem gewaltigen Meer von Ruinen steht.


Wieder wandere ich durch die Straßen Frankfurts – schrieb Stempowski am Tag nach seiner Ankunft. Der Tag ist warm und neblig. Durch die Trümmer dringt der Gestank der unterbrochenen Kanalisationsleitungen und der Leichen, die sich in den zugeschütteten Kellern zersetzen (30. November). Was für ein anderer Anblick bietet sich mir, als ich am Tage die Gelegenheit habe, durch Frankfurt zu spazieren! Straßen und Fußwege füllen Verkehr und Stimmengewirr. Inmitten der modernen Hochhäuser sehe ich jetzt in der Sonne unermüdlich arbeitende Kräne – eine Stadt, die ständig expandiert. Wie wenig würde Stempowski Frankfurt noch erkennen, denn der bis heute andauernde Boom begann hier schon in den siebziger Jahren! Er schrieb: Es wäre heute kaum zu erraten, dass die letzten fünfzig Jahre lang Frankfurt eine Stadt war, von der die Einwohner Preußens träumten. In Frankfurt an der Oder, in Küstrin, sogar in Königsberg dachten Tausende an eine Fahrt nach Westen: ins Rheinland, nach Hamburg, Frankfurt (30. November). Frankfurt, heute global und heterogen wie New York oder London, ist wieder ein Objekt von Seufzern, wie es vor dem Krieg war, wieder eine Art gelobtes Land.
Wie sehr anders als das polnische, das deutsche Denken über die es umgebende Welt ist, verdeutlicht folgende Anekdote: ein kleiner Junge, der resolute Sohn polnischer Emigranten, die sich in einer Stadt in Nordrhein-Westfalen (dem westlichsten Bundesland Deutschlands) niedergelassen haben, verband sich auf Skype mit seiner in Polen lebenden Großmutter. Auf die Frage der Oma, ob er keine Angst gehabt habe, allein zur Schule zu gehen, antwortete der Junge: Nein, denn ich habe unterwegs Mohammad getroffen und wir sind zusammen gegangen.
In den ersten Tagen des Jahres 1945 schrieb Stempowski: Meine Reise nähert sich dem Ende. Auf mich wartet ein langer Weg zurück. Noch mehr als die überfüllten Waggons und durchwachten Nächte belastet mich der Gedanke an die weiterhin andauernde Verblendung der Völker und das Verlöschen jeglicher schöpferischer Fantasie in ihnen (4. Dezember). Und so gehen unsere Wege auseinander (ich hoffe, nur für eine gewisse Zeit). Auf mich wartet auch ein längerer Rückweg, aber in eine andere Richtung – nach Osten.
Leipzig
Seit dem frühen Mittelalter befand sich Leipzig im slavischen Siedlungsgebiet. Daher kommt auch sein frühgeschichtlich ausströmender Name, der so viel bedeutet wie „Lindenort“. Gewiss benutzte ihn schon Bolesław der Tapfere, dessen Monarchie bis in jene Gegenden reichte. Bevor es am Ende des 17. Jahrhunderts erneut unter die Herrschaft polnischer Könige geriet, war Leipzig Zeuge der Hochzeit der polnischen Königstochter Barbara Jagiellonka mit Georg dem Bärtigen, der Religionskriege der Protestanten gegen die Katholiken (Schmalkaldischer und Dreißigjähriger Krieg, während letzterem es sehr zu leiden hatte), sowie einer Epidemie, die in Form von einigen tausend Einwohnern reiche Ernte hielt. Vom 16. bis 19. Oktober 1813 fand hier die sogenannte Völkerschlacht statt, die größte aller Schlachten Napoleons und zugleich seine schwerste Niederlage; am 12. Mai 1884 begann in Leipzig der Prozess gegen Józef Ignacy Kraszewski wegen Spionage für Frankreich. In der Zeit der DDR assoziierte man Leipzig, auch in Polen, vor allem mit der Leipziger Messe, einer großen Ausstellungsveranstaltung, die mit ihren Traditionen bis ins 12. Jahrhundert zurückreicht.
Nachdem ich schon eine gewisse Vorstellung davon hatte, was die Bundesrepublik ist, war die erste Frage, die ich in Leipzig, der nach Berlin bevölkerungsreichsten Stadt Ostdeutschlands, gestellt habe, die nach der „Landesidentität“. Fühlt ihr euch als Sachsen? Eine lokale Aktivistin regte sich auf: Hier bestimmt nicht! Vielleicht in Dresden. Leipzig ist eine sehr offene Stadt, hier wohnen Deutsche aus dem ganzen Land.
Diese Worte sind nicht übertrieben. Das Leipzig von heute ist – sicher zur Freude von Angela Merkel, die in den siebziger Jahren hier Physik studierte – die einzige Stadt im östlichen Teil Deutschlands, die keine Einwohner verliert. Ganz im Gegenteil: keine deutsche Stadt kann sich von der Anziehungskraft heute mit Leipzig vergleichen. Der Slogan „Leipzig – das bessere Berlin“ ist hier ganz und gar nicht übertrieben.

Die Stadt ist in den letzten Jahren zum Mekka von Künstlern aus aller Welt und einzigartiges Zentrum alternativer Kultur geworden, mit Off-Theatern und Kinos, Kunstgalerien und ungezwungener Street Art. Aufschriften auf Leipziger Mauern verkünden Nietzsches Parole vom Tod Gottes und der unbegrenzten Freiheit der Kunst. Die ganze Stadt vermittelt den Eindruck einer riesigen Kunstinstallation. Man sagt hier, dass jeder in Leipzig Maler sei (so wie in Krakau jeder Dichter) und dass es sich kein Maler, der auf der Welt Karriere machen wolle, erlauben könne, sich nicht in einem der Leipziger Ateliers festzusetzen. Einige dieser Orte habe ich besucht. Sie befinden sich in postindustriellen Gebäuden, die gewöhnlich von reichen Unternehmern aus der alten Bundesrepublik von der Stadt gekauft und dann mit dem Gedanken an junge Künstler umgestaltet wurden.
Während der Bombenangriffe des Zweiten Weltkriegs hat Leipzig anders als der Rest Deutschlands fast nicht gelitten. Es ist also die einzige große deutsche Stadt, die heute, im Jahre 2018, so aussieht, wie sie tatsächlich vor dem Krieg ausgesehen hat. Das Geld, das anderswo in den hastigen und oft ungeschickten Wiederaufbau gesteckt wurde, war in Leipzig für die Revitalisierung, Konservierung und Verschönerung bestimmt. Mit diesen glücklichen Fügungen des Schicksals lässt sich die einzigartige Atmosphäre der Stadt erklären, über die der Geist der Reformation, Johann Sebastian Bachs und von Goethes Faust schwebt, von dem der Dichter hier, in Auerbachs Keller, Legenden hörte, als er in Leipzig studierte.
In Leipzig erfuhr ich vom Weißwurstäquator. Das ist eine scherzhafte Bezeichnung für die fiktive Grenze, die Deutschland in einen österreichischen Süden und einen preußischen Norden teilt. Die Gründe für diese Teilung entlang dem Breitenkreis haben vielfältigen Charakter: kulinarisch, sprachlich oder geographisch. Nach dieser Unterscheidung, die quer zur Grenze zwischen West und Ost verläuft, wäre Leipzig bereits eine Stadt des Nordens. Ich weiß nicht, aus welcher Epoche Begriff und Idee des „Weißwurstäquators“ stammen, aber selbst wenn sie in die Zeiten vor dem Eisernen Vorhang zurückreichen, was übrigens seine Berechtigung in der älteren Geschichte Deutschlands fände, erweisen sie sich heute vorzüglich als Form der Entschärfung stereotypischer Antagonismen.
Am 9. Oktober 1989 gingen 70.000 Personen auf die Straßen Leipzigs, um ihren Widerstand gegen das DDR-Regime auszudrücken. Zum Erstaunen der Apparatschiks skandierten sie damals: „Wir sind das Volk!“. Zentraler Punkt jener friedlichen Revolution war die evangelische Nikolaikirche, wo einst die Uraufführungen der Orgelwerke Bachs erklungen waren. Im Moment kann man dort eine aus Berlin stammende Fotografieausstellung ansehen, die nationalsozialistische Kriegsverbrechen dokumentiert. Genau einen Monat später fiel dann die Berliner Mauer. Adam Krzemiński schrieb dazu: Das war keine deutsche Revolution, sondern unsere, die der Völker Ostmitteleuropas. Zu ihr trugen die Fluchten aus der DDR und die hiesige Protestbewegung, die Öffnung des Eisernen Vorhangs in Ungarn und der Frühling der Solidarność 1989 mit dem polnischen Runden Tisch bei, bei dem die Systemrochade ausgehandelt wurde, um dann durch den großen Sieg der Solidarność bei den Wahlen vom 4. Juni bestätigt zu werden.
Im Leipziger Einwandererviertel befindet sich die Eisenbahnstraße, die allgemein als die gefährlichste Straße Deutschlands gilt. Die Überzahl stellen hier Syrer und Türken, aber es gibt auch Neuankömmlinge aus dem Irak oder Afghanistan. Ich fuhr dorthin zu einem Treffen mit einem Syrer, der vor zwei Jahren nach Leipzig gezogen ist und dort heute eine breit angelegte Aktivität für die lokale Gemeinschaft durchführt. Der Gastgeber war, wie er erzählte, in seinem früheren Leben Anwalt und hat in der Heimat seine Frau und drei Kinder zurückgelassen, die er nicht zu sich holen darf. Ich hörte aber auch Stimmen, er sei in Syrien sicher Polizist in den Diensten des Apparats von Baschir al-Assad gewesen. So oder so kam er auf der Flucht vor dem IS nach Deutschland, lernte rasch die Sprache und begann mit seiner Tätigkeit zur Integration von Immigranten und Deutschen. Seine erste Aktion war es, für Moslems und Christen gemeinsame Weihnachtsfeiern zu organisieren.
Zum Abschied äußerte er völlig unerwartet seine Beunruhigung über die politische Lage in Polen. Habt keine Angst vor der Vielfalt. Bei uns in Syrien gab es auch nur eine Religion, eine Sprache und eine Rasse und ich weiß, dass das ganz und gar nicht gut ist. Vielfalt dient allen, sie dient Europa.
Dresden
Noch vor einigen Jahrzehnten war Dresden für die Polen eines der Fenster zur Welt, die Illusion, „im Westen“ zu sein; die Schüler, die sich dorthin zu Klassenfahrten begaben, trugen unvergessliche Erinnerungen ins Land an der Weichsel zurück, die sie bis heute sorgfältig in ihren Herzen und Gedanken verwahren. Die Berliner Mauer fiel, die Illusionen auch. Nach München und Frankfurt, nach Leipzig, macht sich der Reisende, der sich in der Hauptstadt Sachsens aufhält, lange mit dem Gedanken vertraut, dass er sich nach wie vor in Deutschland im Herzen Europas befindet. Obgleich wunderschön und voller Zauber ist Dresden, das zu Zeiten der DDR, und somit nach sowjetischen Vorbildern auch im Bereich der Stadtplanung, wiederaufgebaut wurde, eine Stadt, die sich bei beinahe jedem Schritt als eine Stadt des ehemaligen Ostblocks präsentiert.
Es gibt eine Ausnahme von der Regel. In Dresden befindet sich der Zwinger, ein spätbarockes architektonisches Ensemble und eines der prächtigsten Denkmäler der Epoche. Seine Entstehung ist folgende: der für seine Liebe zum Prunk bekannte sächsische Kurfürst und polnische König August II. beneidete Ludwig XIV. um Versailles und wollte einen ähnlichen, und ähnlich ostentativen, Sitz für sich. Der Bau dauerte einige Jahrzehnte. Der während des Zweiten Weltkriegs zerstörte Zwinger wurde prächtig wiederaufgebaut und dient heute als Museum, eines der wichtigsten und interessantesten in diesem Teil Europas. Hier befindet sich u.a. das Porträt von Charles de Solier, das der in Augsburg geborene Hans Holbein malte und dessen Realismus beim Zeigen von Details wohl bisher kein anderes Kunstwerk erreicht hat.


Die gemeinsame Geschichte Warschaus und Dresdens ist deutlich länger als die der Volksrepublik Polen und der DDR. Sie reicht nämlich bis zur polnisch-sächsischen Union und der Person des schon erwähnten Augusts II., des Starken, zurück, dessen Geist hier allgegenwärtig ist. Zum Glück ragt ein monumental verziertes, farblich dunkelbraunes Dresden stolz unter der Grobheit des Nachkriegsdresdens hervor und verleiht letzterem viel an Klasse und Ernsthaftigkeit. Und so sieht jene an Geist und Körper sächsische Stadt in der Abenddämmerung, verdünnt durch das schwache Licht niedriger Laternen, aus wie die Szenerie eines stilvollen Spionagefilms aus den Zeiten des Kalten Kriegs.
Dies ist ein etwas heiteres Bild, wenn wir die, literarisch von Kurt Vonnegut in seinem berühmten Roman „Schlachthaus Fünf“ literarisch dargestellte, Tatsache der beispiellosen Bombardierung Dresdens in der Nacht vom 13. auf den 14. Februar 1945 in Betracht ziehen. Damals kamen während der Flächenbombardements etwa 25.000 Menschen um, zu einem großen Teil Flüchtlinge, die hierhin gekommen waren, um eine Zuflucht zu suchen, in der sie die schon letzten Momente des Krieges würden abwarten können. Die Stadt wurde im Laufe von kaum einigen Momenten in eine komplette Ruine verwandelt.
In seinem Tagebuch schrieb Victor Klemperer, einer der Augenzeugen der Bombardierung Dresdens: Man hörte sehr bald das immer tiefere und lautere Summen nahender Geschwader, das Licht ging aus, ein Krachen in der Nähe … Pause des Atemholens, man kniete geduckt zwischen den Stühlen, aus einigen Gruppen Wimmern und Weinen … neues Herankommen, neue Beengung der Todesgefahr, neuer Einschlag. Ich weiß nicht, wie oft sich das wiederholte. Plötzlich sprang das dem Eingang gegenüber gelegene Kellerfenster der Rückwand auf, und draußen war es taghell. Jemand rief: „Brandbombe, wir müssen löschen!“ Zwei Leute schafften auch die Spritze heran und arbeiteten hörbar. Es kamen neue Einschläge, aber vom Hofe her ereignete sich nichts. Und dann wurde es ruhiger, und dann kam Entwarnung. Zeitgefühl war mir verlorengegangen. (Ich will Zeugnis ablegen bis zum Letzten, 22.-24. Februar 1945).
Michał Głowiński nannte Klemperers Tagebuch ein „monumentales“ Werk, und Leszek Kołakowski „einen klassischen Text dieser Gattung“. Etwas skeptischer, jedenfalls wenn es um die Passagen zu den alliierten Bombenangriffen geht, war W.G. Sebald, der unermüdlich die Unmöglichkeit einer literarischen Beschreibung des Luftkriegs durch Deutsche zu beweisen suchte. Er schrieb: Selbst der Tagebucheintrag Victor Klemperers über das Ende von Dresden bleibt innerhalb der von der sprachlichen Konvention gezogenen Grenzen. Nach dem, was wir heute wissen über den Untergang Dresdens, dünkt es uns unwahrscheinlich, dass einer, der damals von Funken umstoben auf der Brühlschen Terrasse gestanden und das Panorama der brennenden Stadt gesehen hat, davongekommen sein soll mit ungetrübtem Verstand. Das anscheinend unbeschadete Weiterfunktionieren der Normalsprache in den meisten Augenzeugenberichten ruft Zweifel herauf an der Authentizität der in ihnen aufgehobenen Erzählung. Der innerhalb weniger Stunden sich vollziehende Feuertod einer ganzen Stadt mit all ihren Bauten und Bäumen, mit ihren Bewohnern, Haustieren, Gerätschaften und Einrichtungen jedweder Art musste zwangsläufig zu einer Überladung und Lähmung der Denk- und Gefühlskapazität derjenigen führen, denen es gelang, sich zu retten. (W.G. Sebald, Luftkrieg und Literatur, München/Wien 1999, S. 34/35).
Wenngleich faszinierend, ist das von Sebald angeführte Problem doch eher eine Frage aus dem Bereich der literarischen Ästhetik. Etwas anderes ist aber Klemperer selbst, dessen Schicksal in gewissem Sinne archetypisch für das eines deutschen Juden ist.
Als Hitler an die Macht kam, war Victor Klemperer ein Mann jenseits der Fünfzig und bekleidete den Lehrstuhl für Romanistik an der Dresdner Technischen Hochschule (von dem er von den neuen Machthabern übrigens verdrängt wurde). Er hatte jüdische Wurzeln, aber die Tradition der Vorväter war ihm völlig fremd; jüdische Themen begann er erst zu studieren, als seine Herkunft offen problematisch zu werden begann. Er heiratete eine Nicht-Jüdin (was ihm die Rettung brachte); schon vorher war er vom Judentum zum Protestantismus konvertiert, nicht jedoch aus konjunkturellen oder religiösen Impulsen, er war nämlich ein Anhänger der Aufklärung, sondern um seine Verbundenheit mit der deutschen Kultur zu besiegeln. Obwohl er sich immer nur und ausschließlich als Deutscher verstand, war er nach den Nürnberger Gesetzen Jude, und damit ein Untermensch, der das über ihn deswegen verhängte Todesurteil fortwährend gleichsam auf die Stirn geschrieben trug. Ein Jude unter nationalsozialistischer Herrschaft, schrieb Leszek Kołakowski, kann wohl nicht einen Moment der Entspannung oder des Humors finden, er ist in jedem Moment gehetzt. (Zapiski podczłowieka z żółtą łatą, in: Gazeta Wyborcza 2000, Nr. 263, S. 30-31).
Aber Klemperer überdauerte Krieg wie Nationalsozialismus. Er trat in die SED ein und kehrte zur Arbeit an der Hochschule zurück. Er starb achtzigjährig 1960 in Dresden als anerkannter Experte u.a. für die NS-Propagandasprache, die er jahrelang sorgfältig studiert hatte. Neben dem erwähnten Tagebuch bleibt das Buch „LTI. Notizbuch eines Philologen“ über die Sprache des Dritten Reichs seine größte Leistung.
Rückkehr
Während dieser ganzen österreichisch-deutschen Reise, die Frühjahr und Sommer 2018 ausfüllte, begleitete mich ständig ein bestimmter Gedanke: Niederösterreich, Oberösterreich, Salzburg, Tirol, Bayern, Baden-Württemberg, Hessen, Thüringen, Sachsen u.a. – alle sind Bundesländer nicht nur dem Namen nach. Für die Bewohner von Innsbruck ist Tirol die Heimat, für die Münchner Bayern. Es gibt nicht ein Österreich oder ein Deutschland. Es gibt auch nicht ein Europa oder einen Westen.
Anders rauscht der Inn, der seine Quellen in den Rätischen Alpen hat, anders die Salzach und anders die Isar, was auf Keltisch „die Reißende“ heißt, auch wenn all diese Flüsse am Ende in die Donau münden. Noch anders klingt der Main, dessen Fluten durch Bayern und Hessen strömen, und weiter in den Rhein.
Staaten entstehen, entwickeln sich, gehen unter, und die Flüsse führen ihre Wasser im Herzen Europas. Städte werden gegründet, ausgebaut und bombardiert, die Wellen der Flüsse aber wiederholen ohne Ende ihre Lieder.
Unsere Welt ändert sich unaufhörlich, denn das ist ihre Natur. Der Topos von Geburt und Tod der Zivilisation, den wir, Menschen des Westens, gerne in uns pflegen, bezieht sich im Grunde nicht auf die Welt, sondern auf uns selbst, die wir nostalgisch auf die angetroffene und vertraute Ordnung blicken. Indessen lehrt uns Huang Po, der große buddhistische Meister aus den Zeiten der Tang-Dynastie, dass Entstehen und Vernichten nicht existieren. Vermeidet in den Kategorien Vergangenheit, Gegenwart und Zukunft zu denken. Die Vergangenheit ist nicht vergangen; die Gegenwart ein flüchtiger Moment, und die Zukunft noch nicht gekommen. Der Westen besitzt keine Dimensionen, man kann also nicht darüber wie über etwas sprechen, was sich durch Anfang und Ende auszeichnet. Es ist eher ein ewiger Mythos, den jede Generation, jede Gemeinschaft, jeder von uns etwas anders erzählt. So wird das Europa des langen Überdauerns, das in den Landschaften, Sprachen und literarischen Traditionen festgehalten ist, – da können wir beruhigt sein – alles überstehen.
Aus dem Polnischen von Markus Krzoska
Teil I: Tagebuch einer Reise nach Österreich und Deutschland
Teil II: Tagebuch einer Reise nach Österreich und Deutschland





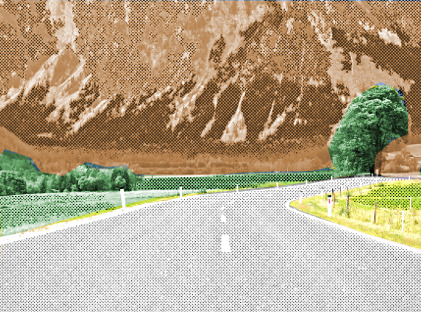


Pingback: Teil II: Tagebuch einer Reise nach Österreich und Deutschland - DIALOG FORUM | Themen aus Deutschland und Polen