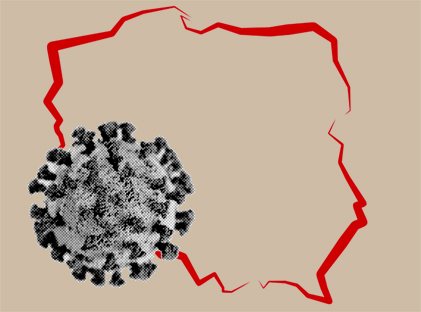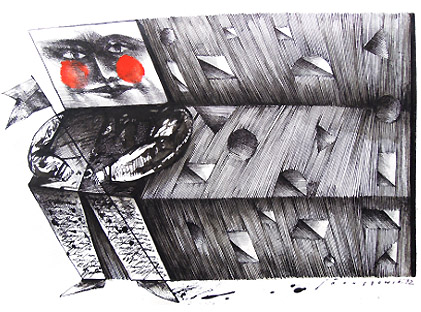Es begann am 28. Oktober, als Kanzlerin Angela Merkel in Absprache mit den Regierungen der sechszehn Bundesländer Deutschlands einen einmonatigen Lockdown ankündigte. Nach Meinung der Experten beginne die epidemische Lage außer Kontrolle zu geraten. Unter die neuen Verschärfungen fiel auch die Entscheidung, ausnahmslos alle Opern und Konzertsäle zu schließen. Sechs Tage vorher in Polen – wo sich das Virus bedeutend schneller verbreitet als in Deutschland und das Gesundheitssystem am Ende seiner Kraft ist – brachen die stärksten Proteste seit Beginn des Systemwechsels von 1989 aus: nach einem Beschluss des Verfassungsgerichts zu Abtreibung.
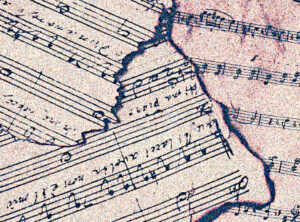 Am Samstag, den 24. Oktober, war das ganze Land zur roten Zone erklärt worden, aber das Fehlen einer klaren Regierungsstrategie und die misslungenen Versuche, den Lockdown „light“ zu managen, verstärkten nur den Eindruck des allgegenwärtigen Chaos. Kulturveranstaltungen gerieten in den Hintergrund. Theoretisch steht der Organisation von Konzerten und Vorstellungen nichts im Wege – unter den, nicht immer eingehaltenen, Bedingungen, dass die Zuschauer nur jeden vierten Platz im Saal einnehmen, sie den Abstand von anderthalb Metern zueinander einhalten und während der Veranstaltung die Masken nicht vom Gesicht nehmen. Die restlichen Plätze müssen frei bleiben. Die Künstler und Direktoren der Kultureinrichtungen wurden wieder einmal allein gelassen mit ihrer Angst, dem Zorn, dem Frust und ihrer Unwissenheit. Manche fassen eigenständig dramatische Entscheidungen – aus einem Verantwortungsgefühl heraus oder durch situationsbedingten Zwang.
Am Samstag, den 24. Oktober, war das ganze Land zur roten Zone erklärt worden, aber das Fehlen einer klaren Regierungsstrategie und die misslungenen Versuche, den Lockdown „light“ zu managen, verstärkten nur den Eindruck des allgegenwärtigen Chaos. Kulturveranstaltungen gerieten in den Hintergrund. Theoretisch steht der Organisation von Konzerten und Vorstellungen nichts im Wege – unter den, nicht immer eingehaltenen, Bedingungen, dass die Zuschauer nur jeden vierten Platz im Saal einnehmen, sie den Abstand von anderthalb Metern zueinander einhalten und während der Veranstaltung die Masken nicht vom Gesicht nehmen. Die restlichen Plätze müssen frei bleiben. Die Künstler und Direktoren der Kultureinrichtungen wurden wieder einmal allein gelassen mit ihrer Angst, dem Zorn, dem Frust und ihrer Unwissenheit. Manche fassen eigenständig dramatische Entscheidungen – aus einem Verantwortungsgefühl heraus oder durch situationsbedingten Zwang.
„Wir haben es verbockt“, urteilt Cornelius Meister, Generalmusikdirektor der Staatsoper Stuttgart. Damit meint er nicht die Mitglieder seines Ensembles. Mit unmissverständlichen Worten beschuldigt er die gesamte deutsche Gesellschaft, die sich im Kampf mit der Pandemie seiner Meinung nach nicht an vorderster Front behaupten konnte. Der Bundesregierung wirft er vor, voreilig eine Entscheidung getroffen zu haben, die für die Gesamtbevölkerung unverständlich und für die Kulturbranche ungerecht ist. Er kritisiert die Regierenden, sie würden eindimensional denken, keine Unterscheidung zwischen „Freizeiteinrichtungen“ und Kulturinstitutionen machen, die den Menschen, entgegen der Entwicklung, doch Hoffnung und ein Zusammengehörigkeitsgefühl geben, ihren Horizont erweitern und die Möglichkeit für einen vollständigen, humanistischen Blick auf die Wirklichkeit schaffen würden – ganz besonders in der gegenwärtigen Krise.
Kevin Conners, Solist an der Bayerischen Staatsoper München, verlieh seiner Aussage sogar noch einen dramatischeren Ton: Er warnt, der langwierige Lockdown führe zu einem unvermeidlichen Tod der Opernform. Kirill Petrenko, Chefdirigent der Berliner Philharmoniker, beendete sein letztes Konzert im Oktober mit dem bekannten Werk 4’33” von John Cage, d.h. mit viereinhalb Minuten vielsagender Stille nach einem erneuten Urteilsspruch für das deutsche Musikleben.
Es fällt schwer, sich über die Reaktionen zu wundern. Obwohl die Musik in Deutschland nach dem Ausbruch der Pandemie schrittweise verstummte – je nach Wucht der Verschärfungen, die die Regierungen der einzelnen Bundesländer unabhängig voneinander beschlossen –, wurden die Entscheidungen unter Einbeziehung eines großen Expertenkreises aus den unterschiedlichsten Bereichen gefasst. In der schlimmsten Situation befanden sich die Opernhäuser, wo es ohne fundamentale Veränderungen im bisherigen Handlungsmodell keine Möglichkeit gab, die unabdingbaren Sicherheitsvorkehrungen einzuhalten.
Alternativen wurden bereits während des ersten Lockdowns getestet, als man noch im Wirrwarr der Forschungshypothesen und -beurteilungen herumtappte. Immer mehr deutete daraufhin, dass auch symptomfreie Personen eine Ansteckungsquelle für den SARS-CoV-2-Erreger sein können; dass das Virus sich nicht nur über Tröpfchen, sondern auch über die Luft verbreitet; dass das Infektionsrisiko in geschlossenen Räumen deutlich ansteigt. Es begannen langwierige Berechnungen, was man aus diesem Wissen für die Praxis ableiten könne.
Ein langsames „Auftauen“ begann Ende August. Die Organisatoren des Musikfests Berlin stellten ihr ursprüngliches Programm völlig auf den Kopf: Einige der verbleibenden längeren Konzerte teilten sie in zwei kürzere mit einer mehrstündigen Pause dazwischen und beschlossen, den Abschlussabend zweimal zu spielen. Der Zuschauerraum des großen Saals der Philharmonie, wohin alle Veranstaltungen des Festivals verlegt wurden, durfte nur mit 25 Prozent besetzt werden. Das ganze Gebäude wurde in sechs separate Zonen eingeteilt, um unnötige zwischenmenschliche Kontakte zu vermeiden. Das Servicepersonal führte jeden Zuhörer persönlich zum Platz und sorgte dafür, dass die Abstände im Saal eingehalten wurden. Die Masken durften nur während der Konzerte abgenommen werden, die wiederum ohne Pausen organisiert wurden und maximal anderthalb Stunden dauerten. Die Instrumentalisten mussten einen Abstand von mindestens eineinhalb Metern einhalten, die Solisten und Choristen wurden auf die Bereiche verteilt, die für den Publikumsverkehr gesperrt waren. Ähnliche Einschränkungen galten in der Hamburger Elbphilharmonie und bei Konzerten des Symphonieorchesters des Bayerischen Rundfunks in München.
Die Opernhäuser passten sich je nach Gegebenheit und verfügbaren Finanzmitteln an die geltenden Vorgaben an. Die regulären Vorstellungen wurden ersetzt durch Liederabende, Zusammenstellungen von Opernfragmenten, Konzerte unter freiem Himmel oder improvisierte Darbietungen auf Theaterparkplätzen. Im Staatstheater Kassel wurde die Anzahl der Choristen auf ein Dutzend reduziert und sie wurden vom Rest des Ensembles separiert. Auf der Bühne durften sich gleichzeitig nicht mehr als vier Solisten aufhalten: Wenn sie Seite an Seite standen, hielten sie einen Abstand von drei Metern, der sich auf sechs Meter erhöhte, wenn sie von Angesicht zu Angesicht sangen.
In der Bayerischen Staatsoper wurde ein Pilotprojekt eingeleitet – in der Hoffnung, wenigstens ein Viertel des Publikums einlassen zu können, denn gemäß des örtlichen Hygienekonzepts durfte das Theaterhaus knapp 300 Zuschauer hineinlassen. Musiker und das Inszenierungsteam, das zur roten Gruppe gerechnet wurde, wurden regelmäßig getestet und bewegten sich im Gebäude in abgetrennten „Blasen“, die maximal zehn Personen umfassten. Das Garderobenpersonal aus der gelben Gruppe musste die gesellschaftlichen Abstandsregeln einhalten und medizinische Masken tragen. Auch sie wurden getestet, allerdings seltener als die Künstler. Dieselben Regeln – außer der durchgeführten Tests – galten für die Mitarbeiter in der Verwaltung, die zur grünen Gruppe gehörten. Das blau markierte Servicepersonal für die Zuschauer achtete auf die Einhaltung der Hygienemaßnahmen innerhalb des Publikums.
Die einzige „echte“ Premiere – Wagners „Walküre“ in der Regie von Stefan Herheim – fand in der Deutschen Oper Berlin statt. Großzügige Sponsoren übernahmen die Kosten für tägliche Tests des gesamten Ensembles: Die Abstriche trafen früh morgens direkt im Labor ein und noch am selben Tag am Nachmittag lagen die Ergebnisse vor. Buffets blieben geschlossen, Theatershops ebenso. Dank der solidarischen Disziplin entstand in keiner der deutschen Musikinstitutionen ein Coronavirus-Hotspot.
Und dennoch verstummte die Musik von Neuem, die Vorhänge fielen, das Theaterlicht erlosch und damit auch die Hoffnung auf eine baldige Rückkehr zu einer trügerischen Normalität, die mit vielen Entsagungen teuer erkauft wurde. Die Künstler haben viele Gründe, Furcht vor der Zukunft zu haben. In der Kunst zählt nicht nur das Geld. Das gewaltige Rettungspaket der deutschen Bundesregierung – das neben nicht zurückerstatten Zuschüssen für Selbstständige auch Zuwendungen für die Miete des Unternehmens, Anleihen zur Deckung von Verlusten der Institutionen und das Aussetzen laufender Abgaben umfasst – kompensiert doch nicht die hunderten Stunden vergeudeter Proben, den fehlenden Kontakt zum Publikum und die gesellschaftliche Isolation der Musiker.
Dennoch ist das nichts im Vergleich zur Situation ihrer Fachkollegen in Polen, die auf Sozialhilfe aus den Mitteln des Kulturförderfonds nur unter der Bedingung zählen können, dass sie ihre „schöpferischen Leistungen“ so dokumentieren, „dass sie keine Korrekturen erforderten und keine Zweifel an ihrer künstlerischen Natur hervorriefen.“ Das Ministerium fordert außerdem eine Erklärung über das Nettoeinkommen der letzten zwölf Monate. Die Befreiung von der Einkommenssteuer – eine der Hilfsmaßnahmen – gilt ausschließlich im Fall von chronischen Krankheiten, unvorhergesehenen Schicksalsereignissen sowie im Falle von… Naturkatastrophen, zu denen eine Pandemie gemäß den geltenden Bestimmungen nicht gerechnet wird.
Als ob das nicht genug wäre, kündigte das Ressort im Zusammenhang mit dem „schrittweisen Prozess der Rückkehr zur Durchführung von Kulturveranstaltungen“ sowie mit der Schaffung eines weiteren Fonds (dazu gleich mehr) die Rückkehr zu restriktiveren Regeln an, um finanzielle Unterstützung zu erhalten, und türmt den Antragsstellern unzählige bürokratische Hürden auf. Zur Inanspruchnahme der Wohltaten aus dem neuen Kulturförderfonds (mit einem Budget in Höhe von knapp 400 Millionen Złoty) sind ausschließlich Institutionen, Nichtregierungsorganisationen und in der Kulturszene agierende Unternehmen berechtigt.
Nimmt man die langjährigen Versäumnisse im Bereich Bildung und Gesundheitswesen hinzu, stellt sich die Realität der polnischen Opernhäuser und Konzertsäle im Zeitalter der Pandemie geradezu grotesk dar. Hunger leidende Musiker wittern eine Verschwörung und verlangen Aufklärung, warum voll beladene Flugzeuge fliegen, aber in Theatern „unsinnige“ Einschränkungen gelten. Sie nehmen nicht zur Kenntnis, dass man andere Menschen auch ohne Symptome anstecken kann, und aus Angst, jegliche Einkommensquelle zu verlieren, gehen sie trotz Krankheitssymptomen zur Arbeit.
Die zu Beginn der Krise zaghaft keimenden Unterstützungs- und Solidaritätsbekundungen innerhalb des Milieus weichen einem rücksichtlosen Kampf ums Dasein. Die Leiter der Musikinstitutionen verlieren sich in der Flut absurder Vorschriften, versuchen diese (wenn auch ungeschickt) zu umgehen, und sogar dann, wenn sie der Ansicht sind, die geltenden Hygienebestimmungen einzuhalten, verstehen sie dennoch nicht die fatalen Auswirkungen ihrer selbst getroffenen Entscheidung. Beispiele hierfür könnte man nur so aus dem Ärmel schütteln. Man darf nur 25 Prozent der Sitzplätze verkaufen? Dann setzen wir die Zuschauer in einige eng gedrängte Gruppen, der Rest des Zuschauerraums bleibt frei. Das Publikum muss Masken tragen? Gut, dann soll es das, gerne auch nur am Kinn, Hauptsache die Maske ist angezogen.
Selbstverständlich gibt es lobenswerte Ausnahmen. Jedoch werde ich weder jemanden als Beispiel hierfür anführen noch weniger mit dem Finger auf jemanden zeigen, denn mir ist klar, dass es in einigen Fällen um Sein oder Nicht-Sein geht – Institutionen, die von der lokalen Verwaltung ignoriert werden, vom Ministerium boykottierte Unternehmen, Künstler, die der Ablehnung ihres Milieus begegnen. In der jetzigen Situation kommt es vor, dass der fehlende Zugang zu Tests wie ein Segen behandelt wird. Es reicht hingegen eine Handvoll Infizierter, um ein ganzes Theater auf Eis zu setzen, ohne dass es die Möglichkeit hätte, irgendein Programm zu realisieren. Einige Orte entwickelten sich zu wahren Virus-Hotspots. Einer davon wurde erst dann publik, als die Affäre im Ausland bekannt wurde. Aber auch das brachte die Entscheider nicht dazu, die Tätigkeit der ganzen Einrichtung unverzüglich einzustellen.
Die Mutigsten und Kreativsten versuchen, ihre Aktivität ins Netz zu verlagern. Der Großteil versucht, die Wirklichkeit zu beschwören und sich bei dem traditionell gesinnten Publikum einzuschmeicheln, das „wahre“ Aufführungen und Operngalas mit den lokalen Sternchen verlangt. Fügen wir hinzu – ein Publikum, das mitunter herzlos ist. Auf der Seite eines Theaters erschien unterhalb der Bekanntmachung, eine Vorstellung müsse „aus Gründen, die außerhalb der Kontrolle der Organisatoren lägen“, abgesagt werden, ein Kommentar mit dem Vorwurf, damit würde man das Publikum missachten, und mit der Frage, wer dem Interessenten das Geld für die Reise erstatten würde.
Die Helden sind müde, desorienteiert und immer häufiger einfach ratlos. Sie sind hin- und hergerissen zwischen Furcht und Verleugnung. Sie beneiden ihre Kollegen, unter anderem in Deutschland, verharrend in dem Gefühl, dass es ihnen besser erginge, dass dein Lockdown besser als meiner wäre, dass man im Ausland sogar als Tellerwäscher würdevoller leben würde als ein Künstler in einem Staat aus matschigem Karton. Vielleicht gehen auch sie schon in Kürze auf die Straße, um an dem „Karneval der Freiheit“ teilzunehmen, „die uns keiner der verängstigten Mistkerle nehmen wird“ – wie es die Aktivistinnen des Gesamtpolnischen Frauenstreiks auf Twitter schrieben. Möge es nicht der Karnevalsdienstag sein. Möge danach nicht eine Fastenzeit folgen, die so lange andauert, dass niemand mehr überleben wird. Mögen diese Bäume im Frühling neue Triebe werfen.
Aus dem Polnischen von Ricarda Fait