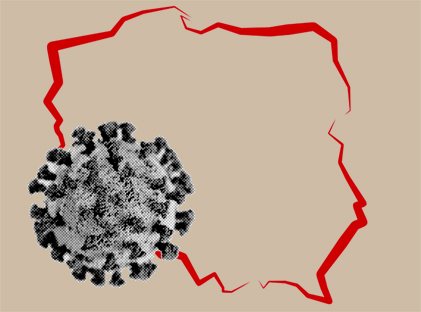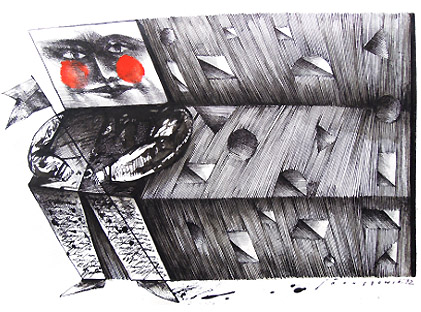Schon heute, gut ein Jahr nach Ausbruch der Corona-Pandemie, ist klar, dass wir es mit dem wohl härtesten globalen Einschnitt seit der epochalen Zäsur von 1989/90 zu tun haben. Allerdings könnte der Gegensatz zu 1989 kaum größer sein. Damals bescherte der Fall der Mauer das Ende des Warschauer Pakts und den Sturz der kommunistischen Diktaturen. Diesmal ist es der „Führer der freien Welt“, Donald Trump, den das historische Ereignis aus dem Amt katapultiert hat.
Die Geschichte wiederholt sich also, allerdings nicht als Farce, aber doch unter fast umgekehrten Vorzeichen. Was 1989/90 der Niedergang des Sowjetimperiums war, ist 2020 das Ende der US-Regierung – und das just in dem Moment, als Trump die Macht mit autokratischen Mitteln zu verteidigen suchte. Corona wurde damit zum Game changer.
Doch während damals der Osten fundamental betroffen war und sich im Westen wenig bis nichts ändern musste, stehen heute die westlichen Demokratien im Feuer. Zugleich sitzt das autoritäre Regime in China – als der Ausgangspunkt der Pandemie – fester im Sattel als zuvor. So erweist sich die Coronakrise als jene fundamentale „demokratische Zumutung“, von der die Kanzlerin gesprochen hat. Oder genauer gesagt: als die wohl größte Herausforderung für die Demokratie seit dem Untergang ihres totalitären Kontrahenten 1990.
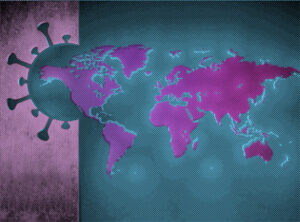 Am Ende dieses Corona-Jahres sind die Demokratien, diesmal von innen massiv herausgefordert, an der Grenze ihrer Handlungsfähigkeit angelangt. Das gilt auch für Deutschland. In keinem der 75 Jahre ihres Bestehens wurde die Bundesrepublik nicht nur derart massiv ökonomisch heruntergefahren, sondern zudem das Verhältnis von Staat und Gesellschaft so grundsätzlich verhandelt wie 2020.
Am Ende dieses Corona-Jahres sind die Demokratien, diesmal von innen massiv herausgefordert, an der Grenze ihrer Handlungsfähigkeit angelangt. Das gilt auch für Deutschland. In keinem der 75 Jahre ihres Bestehens wurde die Bundesrepublik nicht nur derart massiv ökonomisch heruntergefahren, sondern zudem das Verhältnis von Staat und Gesellschaft so grundsätzlich verhandelt wie 2020.
Systemkritik von rechts
Und auch hier erlebten wir eine erstaunliche Verkehrung der politischen Vorzeichen. Radikale Staats-, ja Systemkritik kommt heute nicht mehr von links, sondern von rechts. Die angeblich neuen Konservativen, als die sich die Mitglieder und Anhängerinnen der AfD gerne etikettieren, entpuppten sich als libertäre Anarchisten und radikale Anti-Etatisten, die sogar mit erwiesenen Staatsfeinden wie den Reichsbürgern beim versuchten „Sturm auf den Reichstag“ gemeinsame Sache machen – als rechte antiparlamentarische Opposition.
Mit der Vorstellung eines angeblichen „Great Reset“ wird eine Revolution von oben gegen das Volk herbeiphantasiert – durch den Deep State als die Vertretung der „Globalisten“, von Bill Gates bis George Soros. Vor allem aber erwies sich die rechte Opposition als ausschließlich von Egoismus getrieben, als dem Gegenteil von staatspolitischer Verantwortung. Wenn sie von Freiheit und „Eigenverantwortung“ spricht, um damit die staatlichen Einschränkungen zu kritisieren, dann verbirgt sich dahinter entweder ein naiv gutmeinendes Menschenbild – auch das alles andere als konservativ –, oder (und vor allem) das radikal egoistische Anliegen, vom Staat primär eines zu wollen: absolut in Ruhe gelassen zu werden und keinerlei Einschränkungen zu unterliegen.
Auf der anderen Seite erlebte man eine erstaunliche neue Koalition aus Christdemokraten bzw. -sozialen und der gesammelten potentiellen Linken im Lande, von Linkspartei, SPD und Grünen. Wollte man die Webersche Unterscheidung von Verantwortungs- und Gesinnungsethik bemühen, so könnte man in ihnen die Verantwortungsbewussten sehen, während sich AfD und teilweise auch die FDP allein ihrer infantil-egoistischen „Gesinnung“ verpflichtet fühlen.
Offene Staatsfeindschaft gegen die Verteidigung der intervenierenden Rolle des Staates, lautet somit die zentrale Auseinandersetzung dieses Jahres. Ein Jahr nach Ausbruch der Corona-Pandemie steht daher noch ein weiteres fest, dass nämlich 2021 noch wichtiger werden könnte als 2020.
Vorsorge lernen
In den Debatten dieses Superwahljahres wird sich erweisen müssen, ob die entscheidenden Konsequenzen aus der Coronakrise gezogen werden. Denn Corona ist nur ein Vorschein der Klimakrise als der eigentlichen Jahrhundertfrage, die in ihren Auswirkungen noch weit über jene der derzeitigen Seuche hinausgehen wird. Die Ausbreitung von Corona kennt keine Feiertage, heißt es zu Recht. Doch was für das Virus gilt, gilt für die Erderwärmung erst recht.
Von Corona lernen, heißt daher Vorsorge lernen. Wenn wir heute nichts radikal ändern, landet schon morgen der gesamte Planet auf der Intensivstation – ohne Aussicht auf Heilung. Die große Frage ist daher, ob die Demokratien die Handlungsfähigkeit aufbringen, derer es bedarf, um die Klimakatastrophe zu bekämpfen – und das in noch weit grundsätzlicherer, an die Fundamente unserer Lebensform gehender Weise als gegen Corona. Denn mit ihren CO2-Emissionen ist die seit 1989/90 globalisierte westlich-konsumistische Lebensweise der Superspreader der Klimakrise.
Auch was die Handlungsnotwendigkeiten anbelangt, ist daher der Vergleich mit der letzten historischen Zäsur erhellend. 1989/90 war ein Jahr der globalen Öffnung, der grenzenlosen sozialen Kontakte. Zugleich fungierte der Mauerfall als Auslöser eines rasenden Individualismus: Die 90er Jahre wurden zur Dekade eines rauschhaften Lebens im Hier und jetzt, aber damit zugleich der Zukunftsvergessenheit. Was zählte, waren Lustmaximierung, Spaß und Hedonismus, mit der Love Parade („Friede, Freude, Eierkuchen“) als dem Signum der Zeit. „Unterm Strich zähl ich“, war das Leitmotiv der 90er. Wo zuvor noch wir gewesen war, sollte nur noch ich sein. „There is no society, there are only individuals and families“, lautete der Schlachtruf der Neoliberalen.
1989/90 als globale Entgrenzung
Die 90er Jahre schienen eine Welt der unbegrenzten Möglichkeiten zu sein. Parallel dazu wurde mit dem Erdgipfel von Rio im Jahr 1992 die schöne Utopie der „Einen Welt“ erzeugt, die sich jedoch immer mehr als Farce entpuppt. Heute sehen wir eine zutiefst gespaltene Welt, gekennzeichnet durch das millionenfache Elend von Flüchtlingen in desaströsen Lagern, ob in Libyen oder Syrien, der Türkei oder in Griechenland. Und denkt man an die Maßnahmen gegen die Umweltkrise, waren es dreißig verlorene Jahre, Jahre der Verantwortungslosigkeit – ohne jede Vorsorge. Allen internationalen Kodifikationen zum Trotz obsiegte am Ende allein das nationalistische oder individualistische Nutzenkalkül. Donald Trump, der Narziss im Oval Office, war insofern nur folgerichtig, als Krönung dieser enthemmten Epoche.
Mit dem Ausbruch der Coronakrise und Trumps Abwahl ist diese 30jährige Ära der Entgrenzung an ihr Ende angelangt. 2020 wurde zum Jahr des social distancing, der Begrenzung jeglicher Kontakte. Der Staat kehrte zurück und regierte in zuvor schier ungeahnter Weise in den privaten Bereich hinein. Und zwar – und darin liegt der große Unterschied zur Lage im Ostblock vor 1989/90 – zum Schutz seiner Bürgerinnen und Bürger und zudem mit deren ganz überwältigender Zustimmung, aus Einsicht in die Notwendigkeit. Gerade vor dem Hintergrund der vergangenen drei Jahrzehnte stellt sich somit die Frage, was aus der Erfahrung mit der Coronakrise gelernt und bewahrt werden sollte.
Die Lehren aus der Coronakrise
Was heute not tut, ist ein radikaler Bruch mit dem Prinzip der rein ökonomistischen Expansion. Aus einer Epoche der maximalen Entgrenzung seit 1989 muss eine Epoche der Begrenzung werden. Die Verzichtsfrage, die wir in diesem Jahr mit Kontakt- und auch gewisser Konsumzurückhaltung beantwortet haben, stellt sich hinsichtlich der Klimakrise noch weit grundsätzlicher. Denn die gesamte westliche Konsumgesellschaft ist gelebter Trumpismus im Kleinformat.
Die Frage ist, ob das Kollektive, das Gemeinsame, das Denken an die globalen Commons in Zukunft wieder eine Chance hat gegen den Hyperindividualismus. Was hat Vorrang, die Maximierung der Individualinteressen oder das Überlebensinteresse der Gattung – und die Gewährleistung eines guten Lebens für alle? Das ist die entscheidende Frage der nächsten Jahrzehnte.
Mit Blick auf die Coronakrise sind bereits zwei Strategien der Krisenbewältigung erkennbar.
Erstens der konventionelle Weg, der aus den immensen Schulden durch gesteigertes Wirtschaftswachstum wieder herauswachsen will. „Einkaufen ist ein patriotischer Akt“, dekretierte Wirtschaftsminister Peter Altmaier in diesem Sinne die frohe Weihnachtsbotschaft. Und der „Bild“-Chefredakteur sekundierte brav: „Deutschland ging es immer am besten, wenn wir unseren Glauben an eine bessere Zukunft durch Konsum ausgedrückt haben.“
Konsum wird hier – in bestechender Ehrlichkeit – zur eigentlichen und letzten nationalen Leitkultur. In diesem Denken firmiert die bevorstehende Impfung gegen Covid-19 als probates Allheilmittel, um dann unvermindert konsum-expansionistisch weiterzumachen. Das allerdings wäre nur die Rückkehr zum fatalen Status quo ante. Es ist eine verführerische, aber höchst gefährliche Illusion, anzunehmen, mit einem Impfstoff werde plötzlich alles wieder gut. Denn gegen die Klimakrise gibt es keine Impfung.
Die eigentliche Frage lautet daher: Wie immunisiert sich eine Gesellschaft wirklich gegen das nächste Virus – und auch gegen das Virus der Klimakrise? Wie kommen wir heraus aus der systemischen Krise eines wachstumsgetriebenen Kapitalismus, ohne immer wieder nur den Konsum anzukurbeln und damit die Krise immer weiter zu vertiefen? Das ist die zentrale Herausforderung dieses Jahrhunderts.
Konsumorientiertes Lebensmodell ist überholt
Der demokratische Westen verfügt derzeit offensichtlich über keine Alternative zum konsumistischen Lebensmodell, das er nach 1989/90 zum global hegemonialen gemacht hat. Notwendig wäre dafür eine völlig andere Prioritätensetzung – mit Solidarität als dem zentralen Leitbegriff, um nicht zu sagen: der notwendigen nationalen wie globalen Leitkultur.
Die gegenwärtige Krisenbewältigung durch Aufnahme milliardenschwerer Kredite ist dagegen nur eine – wenn auch notwendige – Politik auf Pump. Denn mit den immensen Schulden wird die Frage ihrer Begleichung bloß in die Zukunft verlagert. Zudem ertönt bereits die Sorge, dass auch dem reichen Deutschland bei einem Fortgang der Coronakrise irgendwann „das Geld ausgehen“ könnte. Wer aber stemmt dann die Lasten? Um diese Frage drücken sich derzeit vor allem die Regierungsparteien, die die Beantwortung lieber auf den Tag nach der Bundestagswahl verschieben.
Was dagegen not täte, wäre eine Sonderabgabe Corona, im Sinne eines großen gesellschaftlichen Lastenausgleichs. Denn von der Coronakrise wurde die Bevölkerung höchst asymmetrisch getroffen – die ohnehin Verletzlicheren, da gesundheitlich, aber auch materiell Schwächeren, weit stärker als die besser Situierten.
Neuer Solidaritätsbeitrag
Corona und noch mehr die Klimakrise stellen die Solidaritätsfrage just zu dem Zeitpunkt, so eine weitere Ironie der Geschichte, da der vor dreißig Jahren eingeführte Solidarbeitrag für über 90 Prozent der Steuerzahler ausläuft. Heute aber geht es um einen weit grundsätzlicheren Solidarbeitrag – in nationaler wie internationaler, aber auch in generationeller Hinsicht.
Solidarität ist heute, mehr noch als früher, auch eine Generationenfrage. In diesem Jahr wurde sie von der jungen Generation in ganz überwiegender Weise erbracht, zugunsten der Älteren, der Vulnerableren. Was die Klimakrise anbelangt, stellt sich die Lage dagegen genau umgekehrt dar. Hier sind die Jüngeren allein ihrer längeren Lebenserwartung wegen die Verletzlicheren – und zutiefst abhängig von der konsumistischen Selbstbegrenzung gerade der oft gut situierten Älteren.
Es wäre daher ein großer Schritt in die richtige Richtung, wenn das, was in 2020 an Mobilitäts- und auch an Konsumverzicht geleistet wurde, im neuen Jahr darauf überprüft würde, was davon existenziell für den Menschen ist und worauf getrost verzichtet werden kann. Denn zweifellos gehören extrem klimaschädliche Inlandsflüge nicht zur erforderlichen Grundversorgung – zumal die Coronakrise auch gezeigt hat, was alles spielend mittels digitaler Konferenzen zu bewältigen ist. Fest steht: Angesichts der Klimakrise wird persönliche Selbstbegrenzung zum Schutz der Freiheitsrechte anderer zu einer Grundvoraussetzung der liberalen, freiheitlichen Gesellschaft. Das gilt für Individuen, aber auch für Staaten.
Internationale Solidarität
In der Coronakrise waren die Nationalstaaten fatalerweise primär mit sich selbst beschäftigt. Aus einem banalen Grund: Gegen die Ausbreitung eines Virus kann man nationale und sonstige räumliche Grenzen ziehen, indem man die Mobilität radikal einschränkt. Im Falle der Klimakrise ist das keine Option. CO2 kennt keine Grenzen. Nationale Solidarität wird daher im Kampf gegen die Klimakrise nicht reichen. Und auch im Fall der Coronakrise ist der derzeit aufbrechende Impfnationalismus, passenderweise mit Großbritannien an der Spitze, natürlich fatal.
Internationale Solidarität ist also gefragt, oder pointierter gesagt: Sie muss die eigentliche neue globale Leitkultur werden. Auch weil ein bloß nationaler Kampf gegen die Erderwärmung immer wieder Trittbrettfahrer produzieren wird, die von den Maßnahmen anderer profitieren, ohne sich selbst anstrengen zu müssen – und damit das Argument der Klimawandelleugner evozieren, dass nationale Maßnahmen ohnehin nichts taugen.
2020 ein verlorenes Jahr?
Erforderlich ist daher jetzt eine große internationale Offensive zur Klimaprävention. Die ersten dreißig Jahre seit der Zäsur von 1989/90 wurden verspielt; die nächsten dreißig Jahre darf sich dies auf keinen Fall wiederholen, bei Strafe einer irreversiblen Zerstörung der Atmosphäre. Damit bietet Corona allen Kontaktverboten zum Trotz die Chance, die Welt im Jahr 2021 politisch wieder näher zusammenrücken zu lassen. Entscheidend wird sein, welche Konsequenzen aus dem Ausnahmejahr 2020 gezogen werden. Entweder wir betreiben eine Politik der Prävention wie der Resilienz und ergreifen Maßnahmen der Vorbeugung – oder die Gesellschaft setzt ihren verhängnisvollen Konsumpfad unbeirrbar fort.
„Lost“, verloren, heißt das Jugendwort des Jahres 2020. 2021 wird sich erweisen müssen, ob 2020 tatsächlich ein verlorenes Jahr gewesen ist – oder aber der Beginn eines anderen Entwicklungspfades. Noch ist nicht ausgemacht, ob 2020 nur das annus horribilis mit Hunderttausenden von Corona-Toten sein wird, oder vielleicht doch – die Hoffnung stirbt zuletzt – der Anbruch einer globalen Wende zum Besseren.