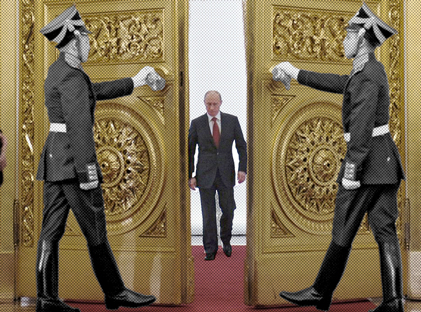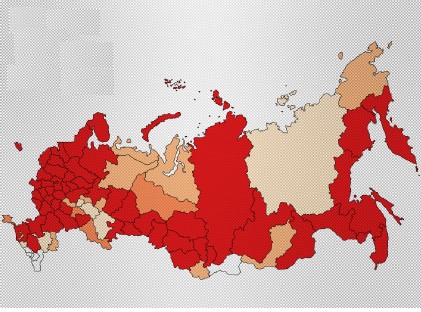Bei vielen, vor allem älteren Deutschen herrscht die Überzeugung, Deutschland sei Russland gegenüber zu Frieden verpflichtet. In dieser Wahrnehmung waren die mehr als zwanzig Millionen Staatsangehörigen der UdSSR, die im Zweiten Weltkrieg umkamen, Russen, obwohl darunter schließlich auch Ukrainer, Belarusen und viele Angehörige anderer Nationen waren. Kaja Puto spricht mit dem Journalisten Reinhard Bingener und dem Journalisten und Historiker Markus Wehner, Autoren des Buches „Die Moskau-Connection“.
Kaja Puto: Woher kommt die Sympathie der deutschen Linksparteien für Russland?
Reinhard Bingener: Es gibt in Deutschland vier linksgerichtete Parteien: die Sozialdemokratische Partei Deutschlands (SPD), die Linke, die Grünen und das neue Bündnis Sahra Wagenknecht (BSW). Jede davon hat ein etwas anderes Verhältnis zu Russland. Im Falle der SPD waren dafür die 1960er und ‑70er Jahre von zentraler Bedeutung, eine Zeit der Entwicklung pazifistischer Bewegungen. Die jungen Sozialdemokraten versuchten damals, die Partei wieder marxistischer zu machen. Zu dieser Generation gehörte der bekannteste der prorussischen Politiker der SPD, Gerhard Schröder.
Die Grünen kamen in demselben ideologischen Klima auf, doch in ihrem Fall gewann schließlich eine Konzeption der Menschenrechte Priorität. Das hat sie dazu gebracht, Stellung gegen Russland zu nehmen und damit, mehr Verständnis für die transatlantische Kooperation zu entwickeln. Die Linke wiederum ist vor allem als postkommunistische Partei zu verstehen. Marxistisches Gedankengut und Antiamerikanismus spielen bei dieser Partei eine noch größere Rolle als in der SPD. Ähnlich sieht es mit dem Bündnis Sarah Wagenknecht aus.
Die SPD ist die größte und älteste dieser Parteien, sie war an vielen Regierungen beteiligt und führt auch die seit 2021 bestehende Regierungskoalition. Sie hatte den größten Einfluss auf die Entwicklung der deutschen Russlandpolitik in den letzten Jahrzehnten. Wie ist es möglich, dass sich in der SPD immer noch ein solch naiver Pazifismus hält?
Markus Wehner: Wie wir in unserem Buch zeigen, gaben für diese naive Politik drei Faktoren den Ausschlag. Der erste ist der in Deutschland verbreitete Antiamerikanismus, der heute besonders im linken politischen Spektrum beheimatet ist und aus dem eine prorussische Einstellung hervorgeht. Der Antiamerikanismus wird stärker, wenn in den USA ein rechtsgerichteter Präsident an die Regierung kommt. Im ersten Jahrzehnt des neuen Jahrhunderts, als George W. Bush US-Präsident war und Wladimir Putin russischer Präsident, sprach sich die SPD-Führung dafür aus, Deutschland müsse gleiche Distanz zu beiden wahren, das heißt es müsse zu Russland ebenso enge Beziehungen unterhalten wie zur NATO.
Die polnische politische Linke ist gleichfalls kritisch gegenüber den USA und den verschiedenen Interventionen der NATO, ist aber deswegen nicht prorussisch.
R.B.: Na klar, aber Russland hat Deutschland nicht so kolonisiert, wie das lange Zeit in Polen der Fall war. In Deutschland war diese Erfahrung auf die DDR beschränkt, das heißt fünfundvierzig Jahre und ein Viertel der Bevölkerung. Dazu kommt die in der deutschen Kulturgeschichte verwurzelte Vorstellung von der Oberflächlichkeit der Vereinigten Staaten und des Westens, der die weite Seele entgegengestellt wird, die angeblich Russen und Deutschen gemeinsam haben. Also spielt dabei kulturelle Arroganz auch eine gewisse Rolle.
M.W.: Und noch ein Faktor, der die deutsche Russlandpolitik beeinflusste, ist das deutsche Schuldgefühl für die in der UdSSR während des Zweiten Weltkriegs begangenen Verbrechen. Bei vielen Deutschen besonders der älteren Generation herrscht die Meinung, wir seien Russland Frieden schuldig. In dieser Logik sind die über zwanzig Millionen Sowjetbürger, die während des Kriegs umkamen, Russen gewesen, während darunter natürlich auch Ukrainer, Belarusen und viele andere Nationen waren.
Und der dritte Faktor?
M.W.: Die Ostpolitik. Diese wurde in den 1970er Jahren von der SPD zur Zeit der Regierung Willy Brandts entwickelt. Anfangs war sie von dem Willen geleitet, eine Annäherung an die DDR zu betreiben, schließlich verwandelte sie sich in eine Politik der Aussöhnung und Annäherung mit dem gesamten Ostblock. Damals wurde die Grenze an Oder und Neiße anerkannt und begann der Handelsaustausch mit der UdSSR und anderen Ländern der Region. Die Bundesrepublik bezog erstmals sowjetisches Erdgas. In derselben Zeit gab die Bundesrepublik vier bis fünf Prozent ihres Bruttoinlandprodukts für Verteidigung aus – gleichzeitig mit der Zusammenarbeit gab es die für den Kalten Krieg typische militärische Abschreckung.
Während ich die erste Phase der Ostpolitik positiv bewerte, war die zweite Phase ein Vorspiel zu der naiven Zusammenarbeit Deutschlands mit der Diktatur, zu der das postsowjetische Russland wurde. Denn die SPD konzentrierte sich in den 1980er Jahren bei der Sicherheitspolitik auf eine Partnerschaft mit den kommunistischen Regimen. Die Sozialdemokraten sahen die Oppositionellen in Polen und der Tschechoslowakei als Unruhestifter. Es reicht der Hinweis, dass sich Willy Brandt während seiner Fahrt nach Polen nicht mit Lech Wałęsa treffen wollte. Viele Sozialdemokraten waren auch gegen die Wiedervereinigung Deutschlands.
Warum?
R.B.: Teilweise deshalb, weil sie nicht wollten, dass Deutschland wieder ein großes, hegemoniales Land in Mitteleuropa würde. Eine Rolle spielte wohl auch ihr Glaube an die Stabilität der sozialistischen Regime und eine gewisse ideologische Nähe.
M.W.: Unbedingt. Als die Vereinigung in Gang kam, las ich einen Bericht von einer Sitzung des SPD-Vorstands. Heidemarie Wieczorek-Zeul, eine Politikerin des linken SPD-Flügels, sagte damals, sollte die Wiedervereinigung die Stärkung der NATO und den Sieg des Kapitalismus mit sich bringen, würde sie mit aller Kraft dagegen kämpfen.
Aber heute brüstet sich die SPD damit, dass die Mauer gerade durch ihre Ostpolitik zum Einsturz gebracht wurde…
M.W.: Als die Wiedervereinigung Deutschlands schließlich allgemein als Erfolg gesehen wurde, machte sich die SPD daran, sie sich selbst zuzuschreiben. Aus ideologischen Gründen wollte sie nicht die Rolle des republikanischen Präsidenten Ronald Reagan und seiner Rüstungspolitik gegen die UdSSR anerkennen oder zum Beispiel diejenige des konservativen Papstes Johannes Pauls II., der zum Umbruch in Polen beigetragen hatte. Daher schufen sie den Mythos der Ostpolitik.
1990, in dem Jahr, in dem sich Deutschland vereinigte, wurde Gerhard Schröder Ministerpräsident von Niedersachsen, eine der Hauptfiguren Ihres Buches. In seiner Jugend war er Marxist gewesen, doch in den neunziger Jahren bewegte er sich und seine SPD auf die große, noch dazu umweltverschmutzende Industrie zu. Wie kam es dazu?
R.B.: Zum Teil erklärt sich das aus den Besonderheiten des Bundeslandes Niedersachsen, das Anteile an großen Unternehmen hat, zum Beispiel Volkswagen. Oder an der Salzgitter AG, einem großen Stahlproduzenten, der seit den 1970er Jahren in der UdSSR Gasröhren herstellte, später übrigens auch für die Nord Stream-Pipeline. Der Ministerpräsident von Niedersachsen sitzt bei diesen Unternehmen im Aufsichtsrat.
Zudem gefiel Schröder diese machogeprägte Welt des großen Business. Dort tauchte er ein in ein Umfeld von älteren Erfolgsmenschen, die ihm durch ihre Risikobereitschaft imponierten, durch ihre gegenseitige Loyalität und ihr Geld. Es fing an mit Freundschaften zu Bikergangs und endete mit Autokraten. Er schätzt Recep Tayyip Erdoğan, er schätzt Wladimir Putin, weil das starke Männer sind, die es zu etwas gebracht haben.
Während sich Schröders Ansichten zur Wirtschaftspolitik verändern, bleibt er bei seinen außenpolitischen Konzeptionen jedoch konsequent. In den 1970er und ‑80er Jahren reist er in die UdSSR, in den 1990er Jahren, als Ministerpräsident von Niedersachsen, nach Russland.
M.W.: Geld spielte für Schröder immer eine wichtige Rolle, selbst als er bereits Bundeskanzler war [1998 bis 2005; K.P.]. Wenn er mit Geschäftsleuten unterwegs war, peinigte ihn die Vorstellung, dass diese alle mehr als er verdienten. Sicher auch daher, weil er aus armen Verhältnissen stammte. Seine Mutter war Putzfrau, der Vater im Krieg gefallen, als er noch ein Säugling war. In der Welt von Macht und Geld war er ein Neureicher.
Wladimir Putin nutzte diese biographische Tatsache aus, um Schröder näherzukommen. Dabei hatte er ein bestimmtes Ziel: Wenige Jahre zuvor hatte er seine Doktorarbeit über den Gasexport als Instrument der Außenpolitik verteidigt.
M.W.: Als er jung war, wurde Putin einmal gefragt, was eigentlich seine Aufgabe beim KGB sei, und er antwortete, er sei Fachmann für zwischenmenschliche Beziehungen. Und tatsächlich ist er darin sehr gut bewandert, er versteht es, sich bestens über das Objekt seines Interesses in Kenntnis zu setzen, über seine Vorzüge und Schwachstellen. Putin stammt ebenfalls aus ärmlichen Verhältnissen, aus einem Leningrader Viertel des zerschlagenen Glases, wie er selbst sagt, ähnlich wie Schröder betrieb er in seiner Jugend Sport und kam mit dem kriminellen Milieu in Berührung, schließlich schaffte er es aber in die Politik und in Machtpositionen.
Zudem schafft es Putin, Leuten das Gefühl zu geben, sie seien wichtig. Er gab Schröder zu verstehen, er, Putin, könne von ihm, dem älteren und erfahrenen Politiker, viel lernen. Er lud ihn zu Privatbesuchen nach Moskau ein, unterhielt sich mit ihm auf Deutsch und ohne Dolmetscher. Die Herren gingen zusammen in die Sauna, zum Schlittenfahren in den Park, und zum sechzigsten Geburtstag Schröders schickte ihm Putin einen Kosakenchor in das Theater von Hannover, um dort die Hymne von Niedersachsen zu singen. Das ging so weit, dass Putin seinem deutschen Freund die Adoption zweier russischer Kinder ermöglichte. Schröder sagte immer wieder, die deutsch-russischen Beziehungen hätten eine Tiefe erreicht wie nie zuvor. In Wirklichkeit sprach er natürlich von seinen privaten Beziehungen.
Wie hat sich diese Freundschaft auf Schröders Innenpolitik ausgewirkt?
M.W.: Schröder stellte die Interessen der deutschen Energieunternehmen als deutsches nationales Interesse hin. Wenn vom Kauf russischen Gases die Rede war, sagte Schröder nicht, dies liege im Interesse der deutschen Energieunternehmen oder der deutschen Wirtschaft, sondern im Interesse Deutschlands. So argumentierte er beispielsweise für den beschleunigten Bau von Nord Stream. Es wurde noch interessanter, als er nicht mehr Kanzler war, aber immer noch aus dem Hintergrund die deutsche Russlandpolitik lenkte.
Nach Schröder wurde Angela Merkel Bundeskanzlerin. Ihre Partei, die CDU, regierte die Bundesrepublik vier Amtszeiten lang, von 2013 bis 2021 auch in einer Koalition mit der SPD.
M.W.: Schröder wurde damals Aufsichtsratsvorsitzender von Nord Stream und damit zu einem Agenten der russischen Energieindustrie. Gleichzeitig schlüpfte er in die Rolle des international angesehenen elder statesman. Und er beeinflusste die deutsche Regierungsbildung. Er platzierte enge Mitarbeiter in ihr, zuerst Frank-Walter Steinmeier als Außenminister, dann Sigmar Gabriel als Wirtschaftsminister.
In der deutschen Energiepolitik galt sehr lange ein Limit; es durften nicht mehr als dreißig Prozent des Bedarfs von einem einzigen Produzenten importiert werden. Unter Minister Gabriel wurde dieses Limit auf 55 Prozent erhöht. Das geschah bereits nach der Annexion der Krim, was für mich unerklärlich ist.
Die Deutschen wurden von ihren Politikern davon überzeugt, das russische Gas sei das billigste. In Ihrem Buch legen Sie dar, dass das nicht den Tatsachen entsprach.
M.W.: Es wurden keine Terminals für Flüssiggas gebaut, die den Kauf von Gas aus anderen Quellen erlaubt hätte oder wenigstens, mit Moskau die Konditionen der Lieferungen auszuhandeln. So machte sich Deutschland vom russischen Gas abhängig und gestattete es den Lieferanten, die Preise zu diktieren. Die Annahme war, Russland sei ein sicherer Lieferant, also sei nichts zu befürchten.
R.B.: Noch dazu wurden deutsche Gasspeicher an Russland verkauft. So lässt sich feststellen, dass Russland die europäische Liberalisierung der Energiemärkte für eigene Zwecke nutzte. Gazprom wurde von einem bloßen Produzenten auch zu einem Inhaber von Gasinfrastruktur, Gaspipelines und Gasspeichern. Darauf stützte Gazprom seine Marktposition. Die Deutschen glaubten, europäische Sicherheit sei ohne gute Beziehungen zu Russland nicht möglich. Und als der volle Krieg ausbrach, stellten sie überrascht fest, dass die Speicher leer waren.
Gerhard Schröder wandelte sich damals zum Bösewicht. Es gab eine Diskussion, ihn aus der SPD auszuschließen, es wurde ihm das Büro für ehemalige Bundeskanzler im Bundestag aberkannt, er verlor die Ehrenbürgerschaft von Hannover. Fühlte sich sonst niemand schuldig?
R.B.: Ich würde das als eine große politische Leistung der SPD bezeichnen. Schröder wurde zum Buhmann, aber andere, für die prorussische Politik ebenso verantwortliche Politiker blieben in ihren Positionen.
Frank-Walter Steinmeier, jetzt Bundespräsident, trat nicht zurück, auch nicht Sigmar Gabriel, der dem Atlantik-Brücke e.V. vorsteht, einer die deutsch-US-amerikanischen Beziehungen fördernden Gesellschaft. Die Ministerpräsidentin von Mecklenburg-Vorpommern heißt immer noch Manuela Schwesig, obwohl sie zur Gründung der berüchtigten Stiftung Klimaschutz beigetragen hat, die eingerichtet wurde, um US-Sanktionen gegen Russland zu umgehen.
Einige versuchten, sich zu rechtfertigen, andere machten sich für einige Wochen unsichtbar. Und als der Staub sich legte, tauchten sie allmählich wieder in ihren Positionen auf.
M.W.: Dem ist aber hinzuzufügen, dass das auf Kosten ihrer Glaubwürdigkeit ging. Am Anfang des Kriegs bot Bundespräsident Steinmeier der Ukraine einen Besuch in Kyjiw an und wurde zurückgewiesen. Und auch Ministerpräsidentin Schwesig ist nicht mehr die große Hoffnung der SPD.
Was hat sich im deutschen linken Spektrum 2022 geändert?
R.B.: Die SPD wandte der Rolle der Energiepolitik für die Verteidigung verstärkte Aufmerksamkeit zu, ferner den osteuropäischen Ländern, nicht nur der Ukraine, sondern auch Polen und den baltischen Staaten. Für die Rüstung wurde mehr Geld bereitgestellt; übrigens ist es Deutschland gelungen, das Ziel von zwei Prozent des BIP für Verteidigung zu erreichen. Bundeskanzler Olaf Scholz selbst hatte schon 2017 eine kritische Haltung zu Russland bezogen. In der Partei gibt es aber immer noch Leute, die darüber spekulieren, wie erneut Kontakt zu Moskau aufzunehmen wäre.
Die Grünen sehen sich in ihrer proukrainischen Haltung bestärkt, sie begannen, mehr von der Stärkung der Verteidigungsfähigkeit zu sprechen und von einer größeren Offenheit der militärischen Bündnisse, vor allem der NATO. Bei der Linken dagegen herrscht weiter das Primat der sogenannten Friedenspolitik und eine extrem kritische Haltung zu NATO und Rüstung.
M.W.: Was die SPD betrifft, sind die öffentlichen Äußerungen des Parteivorsitzenden Lars Klingbeil bezeichnend, der einst enge politische Kontakte nach Russland pflegte. Nach Kriegsausbruch betonte er vielmals, die Deutschen müssten ihren östlichen Partnern in der NATO aufmerksamer zuhören, und heute könne nicht mehr von Sicherheit mit Russland, sondern nur noch von Sicherheit entgegen Russland die Rede sein. Doch vielen altgedienten SPD-Mitgliedern gefallen solche Ansichten überhaupt nicht.
Inwieweit handelt es sich hierbei um eine dauerhafte Neuausrichtung der Sozialdemokraten? Bundeskanzler Scholz macht derzeit den Eindruck, die Militärhilfe ausbremsen zu wollen. Er verweigert die Lieferung von Langstrecken-Marschflugkörpern vom Typ Taurus, zudem kommentierte er öffentlich die verdeckte Beteiligung der NATO bei der Bedienung ähnlicher Raketen in der Ukraine.
R.B.: Es lässt sich nicht mit letzter Sicherheit ausschließen, dass die sogenannten Russlandversteher wieder ihre Stimme geltend machen werden. Meinungsumfragen zeigen eindeutig, dass die Gesellschaft Angst vor der offenen Konfrontation hat. Die meisten Deutschen wollen den russischen Bären nicht reizen, sie meinen, es sei besser, ihn in Ruhe zu lassen, und um das zu erreichen, dürfe man nicht mehr Waffen liefern. Kanzler Scholz ist zwar zweifellos für die Unterstützung der Ukraine, hat aber solche Stimmungen im Hinterkopf.
M.W.: Einwände gegen weitere Waffenlieferungen an die Ukraine sind besonders in Ostdeutschland verbreitet. Obwohl diese Gebiete Erfahrungen mit der sowjetischen Besatzung gemacht haben, ist die Sympathie für Russland, aber auch der Respekt vor seiner Macht immer noch groß. Scholz hat noch ein weiteres Problem: Mit der deutschen Wirtschaft steht es nicht zu besten, und die Bürger bekommen die steigenden Lebenshaltungskosten zu spüren. Deswegen ist der linke Flügel der SPD skeptisch bei einer radikalen Erhöhung der Verteidigungsausgaben. Diese Faktion befürchtet, dass in der Folge Geld für Bildung, Sozialausgaben und Klimaschutz fehlen werde.
In letzter Zeit haben die Kreml-Propagandisten begonnen, dazu aufzurufen, die Bestimmungen der Konferenz zur deutschen Wiedervereinigung für ungültig zu erklären. Eine Wiedergeburt der DDR ist natürlich wenig wahrscheinlich, doch es besteht die Möglichkeit, dass Russland in Zukunft Mitgliedsländer der NATO angreifen wird; diese Möglichkeit ist gering, aber real. Haben die Deutschen Angst vor einem solchen Szenario?
R.B.: Aus deutscher Sicht ist diese Bedrohung weiter weg als für die Polen, und sei es nur, weil wir im Unterschied zu Ihnen keine gemeinsame Grenze mit Russland haben. Ich bin mit Markus einer Meinung, dass die gefühlsmäßige Wurzel des deutschen Umgangs mit Russland die Angst ist, den Bären zu reizen, aber auch eine bestimmte Mutlosigkeit.
Andererseits ist sich heute jeder vernünftige Politiker im Klaren darüber, welche wichtige Rolle dabei die Abschreckungspolitik spielt. Sowohl Polen als auch Deutschland stützten sich dabei auf die US-amerikanische Unterstützung, Deutschland ist zudem Teil der Vereinbarung der NATO zur sogenannten „nuklearen Teilhabe“ im Falle des Einsatzes taktischer Nuklearwaffen. Das Gespenst eines Wahlsiegs von Donald Trump sollte uns jedoch zu der Überlegung veranlassen, ob es nicht Zeit ist, eigene europäische Abschreckungsmittel zu erwerben.
Aus dem Polnischen von Andreas R. Hofmann
Das Interview erschien zuerst auf: Krytyka Polityczna. Wir danken der Redaktion für die Möglichkeit des digitalen Abdruckes.
Reinhard Bingener
Geb. 1979, Redakteur der „Frankfurter Allgemeinen Zeitung“. Studierte evangelische Theologie an der Universität Halle-Wittenberg, in Chicago und München. Seit 2014 berichtet er über die Politik in Niedersachsen, Sachsen-Anhalt und Bremen.
Markus Wehner
Geb. 1963, Historiker und Journalist. Studierte osteuropäische Geschichte, Politikwissenschaften und Slawistik in Berlin, Freiburg/Breisgau und Moskau. Schreibt seit 1996 Beiträge für die „Frankfurter Allgemeine Zeitung“, 1999–2004 für dieses Blatt Korrespondent in Moskau. Zur Zeit schreibt er hauptsächlich über deutsche Innenpolitik.
 Kaja Puto – Publizistin und Redakteurin, spezialisiert sich auf die Themenbereiche Osteuropa und Migration. Sie schreibt u.a. für die Zeitschrift “Krytyka Polityczna” und für n-ost – The Network for Reporting on Eastern Europe.
Kaja Puto – Publizistin und Redakteurin, spezialisiert sich auf die Themenbereiche Osteuropa und Migration. Sie schreibt u.a. für die Zeitschrift “Krytyka Polityczna” und für n-ost – The Network for Reporting on Eastern Europe.