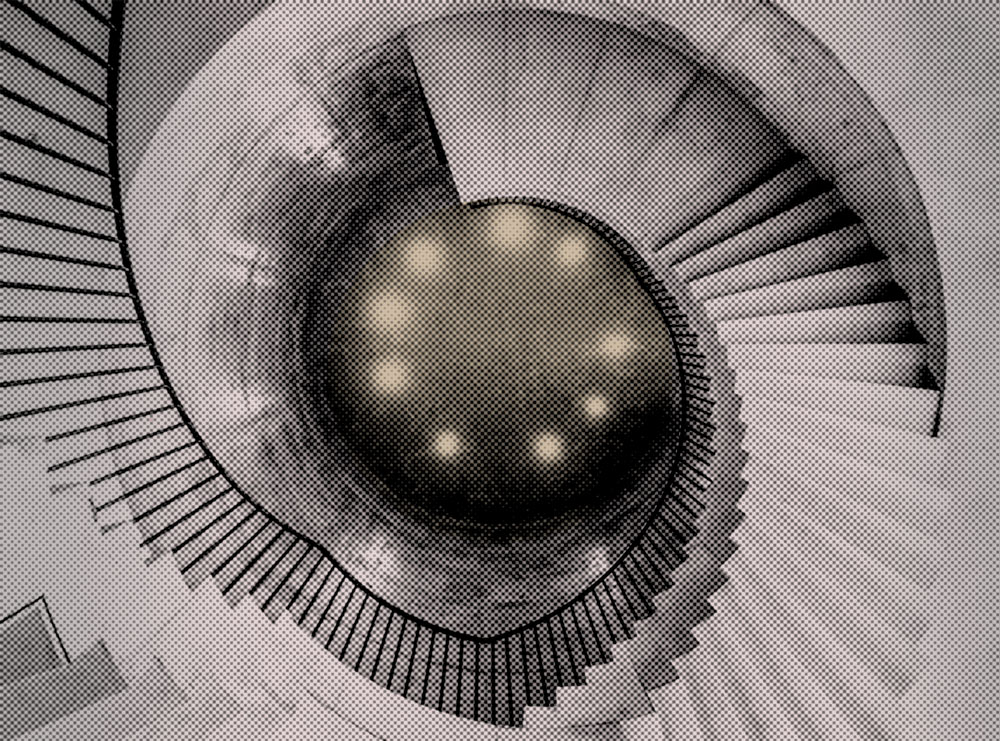Arkadiusz Szczepański spricht mit Prof. Dr. Harald Jähner anlässlich der polnischen Premiere seines Buches „Wolfszeit“.
Arkadiusz Szczepański: In polnischen Buchhandlungen finden sich viele Bücher über Deutschland, die meisten davon haben den Zweiten Weltkrieg zum Thema. Ihr 2019 erschienenes Buch „Wolfszeit. Deutschland und die Deutschen 1945-1955“, das mit dem Sachbuchpreis der Leipziger Buchmesse ausgezeichnet wurde, befasst sich mit der unmittelbaren Nachkriegszeit und ist nun in polnischer Übersetzung (Wydawnictwo Poznańskie: Link wird noch hinzugefügt) erschienen. Wie kam es zu der Idee, das Buch in Polen herauszubringen?
Harald Jähner: Der polnische Verlag Wydawnictwo Poznańskie hat Interesse für das Buch signalisiert und ist an meinen Herausgeber, den Rowohlt Verlag herangetreten, ob das Buch in polnischer Sprache erscheinen könnte. Ich habe mich natürlich sehr gefreut und gleich zugesagt, denn nach der dramatischen, leidvollen Geschichte unserer Länder seit dem Überfall auf Polen dürfte die vielfach unbekannte Nachkriegszeit in Deutschland auch für polnische Leser von großem Interesse sein. Wie wurde aus den Monstern der NS-Zeit die Nachbarn von heute?
Der Titel Ihres Buches ist prägnant. Warum „Wolfszeit“?
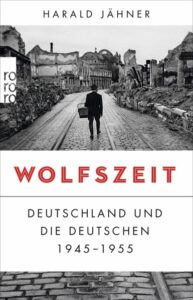
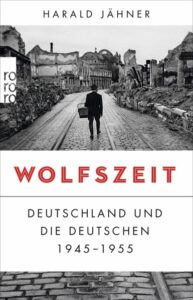
Wie Wölfe Angst vor anderen Wolfsrudeln und auch vor ausgestoßenen, einsamen Wölfen, haben, so hatten die Deutschen Angst voreinander. Im allgegenwärtigen Chaos waren die Menschen auf sich allein gestellt und formten kleine Gruppen, um besser überleben zu können. Es gab eine Menge krimineller Gestalten, die der Krieg demoralisiert hatte, oder auch Jugendbanden, die gefährlich werden konnten. Charakteristisch für diese Zeit war ein ausgeprägter Gruppenegoismus, da ein geordneter Staat oder wenigstens eine Gesellschaft mit verlässlichen Regeln nicht mehr vorhanden waren. Ob Deutschland als souveräner Staat je wieder existieren würde? Die meisten glaubten es nicht. Die Zukunft war absolut ungewiss.
Ab wann ändert sich dies? Mit der Gründung der Bundesrepublik?
Natürlich, das ändert sich 1949 mit der Gründung beider deutschen Staaten, aber die Deutschen haben auch einige Zeit nach Kriegsende angefangen zu verstehen, dass die ehemaligen Feinde nicht auf die erwartete Rache und vollständige Vernichtung erpicht waren, sondern irgendeine Zukunft für das Land gestalten wollten. Wenn wir an die unmittelbare Nachkriegszeit denken, so fällt in Deutschland oft die Formulierung „Stunde Null“. Ich halte diese Bezeichnung für problematisch, denn sie verschleiert gewisse Kontinuitäten, die es zwischen dem Dritten Reich und Nachkriegsdeutschland gab – vor allem die Übernahme der alten Eliten durch die Alliierten und den neuen Staat. Auf der anderen Seite war das Jahr 1945 für den Einzelnen eine derart einschneidende Zäsur, dass der Begriff „Stunde Null“ hier doch seine Berechtigung hat.
Wie würden Sie den Entnazifizierungsprozess im besetzten Deutschland einschätzen?
Die Alliierten, allen voran die Amerikaner, wollten am Anfang eine Schocktherapie durchführen. So wurden etwa viele Deutsche dazu gezwungen, sich Filmaufnahmen aus den Konzentrationslagern anzuschauen, die grauenvolle Bilder mit den Leichen der Gefangenen enthielten. Ziel war es natürlich, sie mit den Verbrechen zu konfrontieren, die von Deutschland begangen wurden. Viele guckten dabei beschämt zu Boden, andere schauten weg oder überspielten ihre Verlegenheit mit einem nervösen Lachen – dann mussten sie sich den Film erneut anschauen. Die Amerikaner merkten recht schnell, dass diese Schocktherapie nicht gut funktionierte und eher Abwehrreaktionen auslöste. Als wirksamer erwies sich, dass die Amerikaner den Deutschen die Demokratie vorlebten, ihnen zeigten, wie Diskussionsprozesse verlaufen.
Ebenso wichtig waren die Erfahrungen, die die Deutschen mit sich selber machten. Oft handelte es sich um unfreiwillige Lernprozesse, etwa mit den Millionen von Vertriebenen. Diese waren alles andere als willkommen in Deutschland, denn Wohnraum, Arbeitsplätze und Nahrung waren knapp. Dabei spielte es keine Rolle, dass es Deutsche waren, „Volksgenossen“. Plötzlich berief man sich wieder auf die Heimatregion und sagte, die Vertriebenen aus dem Osten würden nicht dazugehören. Ein neuer Tribalismus auf kleinerer Ebene machte sich breit. Der positive Nebeneffekt war, dass die Deutschen merkten, dass die unter Hitler so fetischisierte Volksgemeinschaft eine Chimäre war. Die völkischen Mythen zerschellten am realen Gruppenegoismus. Das deutsche Volk als überhöhte Idee war geradezu implodiert. Das Gute daran: die Basis für eine Wiederkehr des Nationalismus war damit verschwunden. Nach der exzessiven nationalsozialistischen Gleichschaltung aller Lebensbereiche waren sich die Deutschen nach 1945 plötzlich in vielen Bereichen fremd geworden. Jetzt wurden die Unterschiede wieder hervorgehoben, wie eben die zwischen den einzelnen Regionen, was sich am deutlichsten in der erwähnten Ablehnungshaltung gegenüber den vertriebenen Deutschen am markantesten zeigte.
Knüpfen wir noch einmal an die Schocktherapie an, die – wie Sie sagen – ein Misserfolg war. Die Auseinandersetzung mit der eigenen Schuld, den Verbrechen vor und während des Krieges, wurde stark verdrängt…
Unmittelbar nach dem Krieg war die Angst vor der Zukunft und die Not so groß, dass man keine Energie hatte, sich mit der eigenen Schuld zu beschäftigen. Angesichts des Überlebenskampfes und des Hungers spielte die kritische Selbstreflexion zunächst eine marginale Rolle. Die Menschen gebrauchten ihre Energie, um grundlegendste Bedürfnisse sicherzustellen. Das gilt für die ersten Nachkriegsmonate, mancherorts auch einige Jahre. Die Nachkriegsjahre waren sehr hart, also keimte langsam das Gefühl auf, man sei genügend bestraft worden. Diese humanitäre Notlage im besiegten Deutschland hatte auch zur Folge, dass die Menschen sich selbst als Opfer fühlten, ja als Opfer einer kleinen Clique von Nationalsozialisten, die sie verführt und ausgenützt hätten. In der Soziologie spricht man in diesem Zusammenhang von Selbstviktimisierung. Während sich die Deutschen selbst als Opfer empfanden, rückten die tatsächlichen Opfer in den Hintergrund. Das schlechte Gewissen der Deutschen wurde durch die eigene Not betäubt.
Dieser Zustand hielt sich fast eine Generation lang aufrecht, es dauerte zwei Jahrzehnte, bis in Deutschland langsam der Prozess einsetzte, sich in immer größeren Dimensionen mit dem Holocaust zu beschäftigen.
War das Ausmaß der deutschen Verbrechen zu überwältigend, als dass eine Aufarbeitung unmittelbar nach dem Krieg hätte erfolgen können?
Das ganze Ausmaß der deutschen Schuld war so gewaltig, dass man es nicht an sich heranlassen konnte, ohne die Kraft für den Wiederaufbau des Landes, ja, für das einfache Weiterleben zu verlieren. Es ist erschreckend, wie wenig Betroffenheit über das verübte Grauen sichtbar gezeigt wurde, wie scheinbar ungerührt viele nach dem Krieg einfach weiterlebten. Im Zuge meiner Überlegungen und Recherchen über diese Zeit wurde mir bewusst, dass hierbei der Aspekt der Kinder, der heranwachsenden ersten Nachkriegsgeneration der Deutschen bei der Verdrängung der Schuld eine Rolle spielte. Wenn man Kinder erziehen will, muss man auch vor sich selbst die Illusion aufrechterhalten, noch die moralische Integrität zu besitzen, die man in Wirklichkeit durch die Vergangenheit verloren hat. Andernfalls hat man keine Autorität, Kindern den Unterschied zwischen Gut und Böse beizubringen. Wenn man sich nun moralisch so schuldig fühlt, wie sich die Deutschen nach dem Krieg hätten eben fühlen müssen, so wäre das ethische Fundament für eine Kindererziehung nicht gegeben. Insofern zwang die Existenz der Nachkommenschaft dazu, das Vergangene auszublenden, zu verdrängen, zu vergessen. Dies ist entsetzlich, wenn man das Geschehen an einer Art von historischer Gerechtigkeit messen will, und unerträglich für alle Opfer, aber für die deutsche Kriegsgeneration war diese Verdrängung so gut wie unausweichlich.
Die Auswirkungen des Krieges waren omnipräsent. Wenn man sich den Wiederaufbau der deutschen Innenstädte anschaut, so drängt sich die Vermutung auf, dass auch im Bereich der Architektur die Vergangenheit vergessen und verdrängt werden wollte…
Ich denke, als besiegte und schuldige Nation haben die Deutschen schnell mit ihrer Vergangenheit, der deutschen Geschichte, abbrechen wollen. Diesen Prozess konnte man auch zum Teil bereits nach dem Ersten Weltkrieg in der Weimarer Republik beobachten. Schon damals riss man lieber Altes ab als es zu restaurieren, etwa die wilhelminischen Bauten. Den Historismus hat man über Generationen hinweg regelrecht gehasst.
Nach dem Zweiten Weltkrieg wurden Verzierungen von den Fassaden bewusst abgemeißelt, alte Fenster gegen neue eingetauscht. Bis heute haben viele Altbauten nur noch glatte Fassaden. Für die alten historischen Stadtkerne hatten die Deutschen nach 1945 einfach keinen Sinn. Schmucklose, funktionale Neubauten markierten den Bruch mit der Vergangenheit und sollten den Weg in eine neue Zukunft weisen. Das betraf auch kleinere Städte und Dörfer, die auf scheußliche Weise saniert wurden und kaum wiederzuerkennen waren. Der architektonische Wiederaufbau zeichnete sich durch eine Bausünde nach der anderen aus, sieht man von den wenigen wirklich originellen Bauwerken der fünfziger Jahre ab. In der Abrisswut manifestierte sich der Deutschen mangelnde Liebe zu ihrer Vergangenheit.
Nicht nur die zerstörten deutschen Städte waren Teil der deutschen Nachkriegswirklichkeit, auch die tausenden von Zwangsarbeitern, die sich im Land befanden. Wie war ihre Lage im Nachkriegsdeutschland? Wie wurden sie von der deutschen Bevölkerung wahrgenommen?
Die Deutschen hatten Angst vor den befreiten Zwangsarbeitern, denn sie fürchteten deren Rache – in einigen dokumentierten Fällen war diese Angst durchaus berechtigt. Nach der Befreiung der Zwangsarbeiterlager irrten diese Menschen in den ersten Wochen und Monaten nach Kriegsende durch ein ihnen fremdes Land, sie hatten Hunger, hegten verständlicherweise Hass gegenüber den Deutschen. Die britischen und amerikanischen Soldaten waren überfordert, die Nahrungsmittelversorgung für diese Menschengruppe zu gewährleisten. Es kam zu Überfällen auf Bauernhöfe, die dann aufgebauscht wurden und angst in der deutschen Bevölkerung schürten.
Die allermeisten Zwangsarbeiter wollten nach ihrer Befreiung zurück nach Hause, aber es gab auch Ausnahmen. Viele, darunter auch Polen, wollten nicht zurück in ihr Land, so paradox das klingen mag. Sie hatten ihre Angehörigen und ihr Zuhause verloren, gerade diejenigen, deren Heimatorte sich nach 1945 erneut in sowjetischer Hand befanden. In Deutschland zu bleiben, schien ihnen eine bessere Option zu sein – nicht unter der Obhut der Deutschen, sondern unter der Obhut der Amerikaner, die die Einrichtungen für die befreiten Zwangsarbeiter betreuten. Deutschland brauchte für den Wiederaufbau dringend Arbeitskräfte. Mit der Zeit erhielten die dagebliebenen ehemaligen Zwangsarbeiter eine Arbeit, meist in der Industrie, und konnten sich ein neues Leben aufbauen. Sie traten zwangsläufig in Kontakt mit der deutschen Bevölkerung und es entwickelten sich sogar gute nachbarschaftliche Beziehungen. Es gibt keine genauen Zahlen, wie viele solcher Menschen in der Bundesrepublik später gelebt haben.
Das schlimmste Schicksal hatten die sowjetischen Zwangsarbeiter, denn sie wurden von offizieller sowjetischer Seite als Feiglinge und Kollaborateure angesehen, die sich gefangen nehmen ließen, statt bis zum Tod gegen die deutschen Aggressoren zu kämpfen. Ihnen drohte bei einer Rückführung in die Sowjetunion erneute Zwangsarbeit oder sogar die Hinrichtung. Dies war den sowjetischen Zwangsarbeitern bewusst und sie wehrten sich vehement gegen deren „Auslieferung“. Britische und amerikanische Soldaten brachten sie unter Zwang in die Züge Richtung Heimat, es spielten sich dramatische, bedrückende Szenen ab.
Kommen wir zum Wiederaufbau Deutschlands, der recht schnell erfolgte. Welche Faktoren waren für das kurz nach dem Krieg erfolgte „Wirtschaftswunder“ entscheidend?
Ausschlaggebend für die rasche Entwicklung Deutschlands war in erster Linie der Kalte Krieg, so seltsam sich das anhören mag. Die zunehmenden Spannungen zwischen den Westalliierten und der Sowjetunion hatten zur Folge, dass sich die Einstellung der Besatzungsmächte zu den Deutschen grundlegend änderte. Die Deutschen wurden in Ost und West von ihren ehemaligen Kriegsgegnern geradezu umworben, die Reparationsforderungen wurden reduziert, wirtschaftliche Hilfe geleistet. Nur wenige Jahre nach dem Krieg sprach man in Westdeutschland nicht mehr von Besatzern, sondern von Freunden, gar von Brüdern. Die Lebensbedingungen verbesserten sich schnell, es wurde viel Hilfe, eine Menge Geld und viele Ideen insbesondere von den USA investiert. Aber auch die Sowjetunion wollte in dem sich abzeichnenden Systemkampf nicht schwach aussehen. Es ist erstaunlich, in welch kurzer Zeit sich die auch die DDR innerhalb des Ostblocks zu einem relativ wohlhabenden Staat entwickelte. Die Russen brauchten die Ostdeutschen, die Amerikaner die Westdeutschen als ihre Verbündeten. Das war ein historisch unverdientes Glück für die Deutschen. Der Preis für diese Umkehr der Beziehungen war die Inkaufnahme der deutschen Teilung und der daraus resultierenden Verhärtung der Fronten: Deutsche standen Deutschen als Feinde gegenüber.
Es ist aus meiner Sicht aber falsch, wenn man die deutsche Teilung immer nur als ein schreckliches Ereignis und großes Leid darstellt. Das war sie zweifelsfrei, sie bot aber auch die genannten Vorteile. Die durch die Teilung begünstigten engen freundschaftlichen Beziehungen der Bundesrepublik zu den Briten, Franzosen und Amerikanern haben die deutsche Mentalität verändert. Die Westdeutschen haben viel von den westlichen Nationen gelernt. Amerikanische Filme, Musik und Lebensstil waren dabei ausschlaggebende Faktoren, die diese Veränderungen innerhalb der deutschen Gesellschaft beschleunigten. Selbst die linke 68er-Bewegung war trotz der leidenschaftlichen Proteste gegen Vietnamkrieg durch und durch amerikanisiert – die jungen Leute trugen damals alle Jeans und modische Militärparkas, die aus den USA stammten.
Gegen Hollywood und Rock ´n´ Roll hatten überkommene deutsche Tugenden keine Chance…
Das ging sogar schon früher los, denn die amerikanischen Soldaten in Deutschland brachten eine bis dahin unbekannte Lässigkeit mit. Die Deutschen haben ganz schön darüber gestaunt, wie lax die sich bewegen konnten, wie entspannt sie sich auch ihren Vorgesetzten gegenüber verhielten. Es gibt einen wunderbaren Tagebucheintrag einer jungen Deutschen, die vor 1945 beim BDM war und sich voller Abscheu über diese weichen Amerikaner äußert, die ohne Haltung über die Straßen schlenderten. Entrüstet wundert sie sich, wie diese Soldaten den Krieg gewinnen konnten.
Das Verhältnis der Deutschen gegenüber den USA ist bis heute zwiespältig und pendelt zwischen Bewunderung und Ablehnung. Wie bewerten Sie dieses Verhältnis? Ist der Antiamerikanismus in Deutschland stark verwurzelt?
Ich denke, dass diese Ambivalenz ganz natürlich ist, wenn man bedenkt, wie stark Deutschland von den USA beeinflusst wurde. Die Sympathien für die USA sind aber heute immer noch wesentlich größer als irrationale Antipathien. Es gibt starke Vorbehalte gegenüber der aktuellen amerikanischen Politik, die jedoch auf nüchternen Überlegungen und den in Deutschland geführten Debatten basieren. Das liegt eben auch an der inkonsistenten Politik der USA, was wir gerade im Falle Afghanistans beobachten können.
Ich bezweifle, dass es einen verwurzelten Antiamerikanismus in Deutschland in großer Breite gibt. Sogar im Dritten Reich gab es viel Bewunderung für die USA. Hitler bewunderte die amerikanische Automobilindustrie, die massenkompatible Fahrzeugproduktion, Coca-Cola war bis zur Kriegserklärung ein beliebtes Getränk, die amerikanische Technik wurde bestaunt. Rassistische Ablehnung und fanatischer Hass wie etwa gegenüber den Russen waren gegenüber den Amerikanern nie stark ausgeprägt.
Apropos Russland. Nur wenige Jahre nach dem Vernichtungskrieg gegen die Sowjetunion gab es plötzlich wieder eine deutsche Armee, die nun auf Seiten des Westens stand. Viele ehemalige Wehrmachtssoldaten und Offiziere, die jetzt in der Bundeswehr dienten, hatten also nach 1945 den gleichen Feind vor Augen, die Sowjetunion. Es mutet an, dass sie sich in der Überzeugung bestärkt sahen, auch vor 1945 einen gerechten Kampf geführt zu haben…
Nein, das glaube ich nicht. Natürlich war die Bundeswehr in die NATO eingebunden und es gab in den ersten Jahren dort Nazi-Cliquen, die alten Militärtraditionen anhingen. Das gab es auch direkt nach dem Krieg, als einige deutsche Offiziere glaubten, an der Seite der Amerikaner den Krieg gegen die Sowjetunion fortsetzen zu können. Das war aber ein kleiner Kreis von Leuten. Die Frontstellung im Kalten Krieg gegen die Sowjetunion war frei von rassistischen Untertönen. Man muss bei diesem Thema daran erinnern, dass unter den NATO-Bündnispartnern es meist die Deutschen waren, die auf Dialog und Verständigung mit der Sowjetunion drängten. In Ostdeutschland waren die Verhältnisse nochmals ganz anders. Die DDR-Eliten pflegten intensive Beziehungen zu den Sowjets, viele studierten in der Sowjetunion, verbrachten dort ihre Jugend. Natürlich wäre der Großteil der DDR-Bevölkerung lieber von den Amerikanern befreit worden, aber das hängt mit der materiellen Überlegenheit der USA und den demokratisch-freiheitlichen Aspekten zusammen, nicht mit alten rassistischen Feindbildern gegenüber den Sowjets. Das kann man heute noch gut beobachten, wenn man etwa das ausgeprägte Verständnis in Ostdeutschland für Putins Politik betrachtet, das von wenig Verständnis für Polens Ängste begleitet wird – obwohl beide jahrzehntelang den gleichen Besatzer hatten.
Nach dem Krieg waren die Deutschen generell des Militarismus derart überdrüssig, dass sie in sehr weiten Teilen zu einer aufrichtig friedliebenden Gesellschaft mutierten, auch mit der Konsequenz, dass ihnen der Frieden wichtiger wurde als die Freiheit. Das hat auch Konsequenzen für die demokratische Entwicklung und den öffentlichen Diskurs nach sich gezogen.
Den Frieden der Freiheit vorzuziehen – Sie pointieren somit den vielleicht markantesten Unterschied zwischen der polnischen und deutschen Mentalität… Herr Professor Jähner, ich bedanke mich für das Gespräch.


Harald Jähner, Jahrgang 1953, war bis 2015 Feuilletonchef der «Berliner Zeitung», der er seit 1997 angehörte. Zuvor war er freier Mitarbeiter im Literaturressort der «Frankfurter Allgemeinen Zeitung». Seit 2011 ist er Honorarprofessor für Kulturjournalismus an der Universität der Künste Berlin. 2019 erschien das Buch „Wolfszeit. Deutschland und die Deutschen 1945 – 1955“, das mit dem Preis der Leipziger Buchmesse ausgezeichnet wurde und monatelang auf der Bestsellerliste des „Spiegel“ stand.
Arkadiusz Szczepański studierte Slawistik, Geschichte und Kulturwissenschaft in Leipzig und Berlin. Redakteur beim DIALOG FORUM, Übersetzer und Redaktionsmitglied des Deutsch-Polnischen Magazins DIALOG.